Jedes Jahr beginnt mit dem 24. Juni der Monat der Selbstfürsorge, welcher mit dem Tag der Selbstfürsorge am 24. Juli endet. Gewählt wurde dieser Tag nicht ohne Grund. Er steht symbolisch dafür, dass Selbstfürsorge „24/7“ also „24 Stunden am Tag/7 Tage die Woche“ praktiziert werden sollte.
Aber was ist Selbstfürsorge eigentlich? Die WHO definierte Selbstfürsorge wie folgt: „Förderung und Erhaltung der eigenen Gesundheit durch Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften, die Vorbeugung von Krankheiten und die Bewältigung von Krankheiten und Behinderungen, mit oder ohne Unterstützung durch Gesundheitsfachkräfte“. Eine weitere Definition der WHO ist: „Selbstfürsorge ist das, was Menschen für sich selbst tun, um Gesundheit herzustellen und zu erhalten und um Krankheiten vorzubeugen und mit ihnen umzugehen. Es handelt sich um ein weit gefasstes Konzept, das Hygiene (allgemein und persönlich), Ernährung (Art und Qualität der verzehrten Lebensmittel), Lebensstil (sportliche Aktivitäten, Freizeit usw.), Umweltfaktoren (Lebensbedingungen, soziale Gewohnheiten usw.), sozioökonomische Faktoren (Einkommensniveau, kulturelle Überzeugungen usw.) und Selbstmedikation umfasst.“
Vor allem für alle in der (Notfall-)Medizin tätigen Personen sollte Selbstfürsorge ein wichtiges Thema sein, da unser Beruf geprägt ist durch Belastungen und Stressoren jeglicher Art.
Aus diesem Grund dreht sich heute bei FOAMio alles um das Thema der beruflichen Belastungen, gesundheitlichen Probleme und weitere Aspekte in der Notfallmedizin, die unsere psychische und physische Gesundheit gefährden.
Wortbestimmungen
Zu Beginn sollten neben dem Begriff „Selbstfürsorge“ noch ein paar weitere Begrifflichkeiten geklärt werden.
Was ist Stress?
Stress ist „ein Anspannungszustand, der als physische und psychische Reaktion auf eine Beanspruchung hin eintritt“, wobei Beanspruchung hier ein Ereignis meint, „das von Menschen eine sofortige Veränderung oder Anpassung des Handelns verlangt“ (vgl. Luthiger-Stocker 2008). Stress ist also primär nicht immer etwas Negatives, sondern erst einmal Zustand körperlicher Aktivierung und geistiger Konzentration. Deshalb erfolgt auch die Unterteilung in Dis- und Eustress, wobei Disstress hierbei negativen Stress und Eustress positiven Stress meint. Eustress ist die Symbiose von Arbeit/Leistung und Erholung/Entspannung und Distress krankmachender Stress mit Erschöpfung und Überforderung. Die oben beschriebene Definition von Stress ist aber um einen Faktor zu ergänzen, da die o.g. Beschreibung von einer quasi völligen Unspezifität der Stressreaktion ausgeht. Dies konnte über die letzten Jahre in vielen Untersuchungen widerlegt werden, da die körperliche Reaktion stark davon anhängt, wie die betroffene Person mit dem Stress umgeht.
Exkurs „Wie verläuft eine Stressreaktion?“
Realisiert das Gehirn eine Stresssituation bzw. Gefahr, so wird das Sympathikus-Nebennierenmark-System aktiviert. Es kommt zur erhöhten Produktion von Adrenalin und Noradrenalin (Fight-or-Flight-Reaktion) mit der Aktivierung der Muskulatur & Sinnesorgane, Erhöhung der Atemfrequenz, Weitstellung der Bronchien und Blutdruckerhöhung sowie der erhöhten Produktion von Cortisol (Freezing-Reaktion) mit Dämpfung der Aktivitätsbereitschaft, Reduktion der Gedächtnisleistung und schlussendlich der Stressreduktion. Die Reaktion des Körpers auf biochemischer Ebene wird auch Cannon-Reaktion genannt. Die Stressreaktion sorgt für einige Probleme, v.a. für eine Beeinträchtigung der Feinmotorik sowie ein verändertes Denken und Fühlen. I.d.R. klingt die akute Stressreaktion nach wenigen Minuten wieder ab und hat keine bleibenden Auswirkungen. Jedoch kann permanenter Stress mit einer Schwächung des Immunsystems und der Entstehung von Herz- Kreislauferkrankungen einhergehen.
Was sind Stressoren?
Stressoren sind Objekte, Reize, Ereignisse und Situationen, die bedrohlich sind oder wirken und zu Schädigungen führen können. Abhängig von ihrer Stärke und Bewältigungsfähigkeit kann es zu einer Stressreaktion kommen.
Gliedern lassen sich die Stressoren in folgende Gruppen:
- Alltagsstressoren, belastende Alltagsereignisse (Mikrostressoren)
- kritische Lebensereignisse (Makrostressoren), also subjektiv belastende Lebensumstände, die räumlich und zeitlich begrenzt sind
- traumatische Ereignisse (Makrostressoren), also äußere Ereignisse außergewöhnlicher Bedrohungen oder katastrophenartigen Ausmaßes
- Typ-I-Trauma(tisches Ereignis): einmalig, begrenzte Dauer
- Typ-II-Trauma(tische Ereignisse): wiederholte, langandauernde Ereignisse
Typische Stressoren, welche uns in der Notfallmedizin begegnen, sind z.B.
| einsatzbedingte Stressoren | berufs- und standespolitische Stressoren | innerbetriebliche Organisationsabläufe als Stressoren |
|---|---|---|
| – Geräusche – optische Eindrücke – Gerüche – Witterung – Verantwortung für Patient*innen & Kolleg*innen – ständige Entschweidungsnotwendigkeit – rascher Wechsel zwischen Ruhe- & Anspannungsphasen – unbestimmte Längen von Pausen bzw. Wartezeiten – lange Arbeitszeiten – Schicht-, Nacht-, Wochend-, & Feiertagsarbeit – Ermüdung, Schlafmangel/-entzug – Angst um eigene Sicherheit – Belastung durch Tragen/Heben – Umgang mit Patient*innen – emotionelle Anforderungen | – Kosten- & Einspardruck – Rollenunklarheit/-vielfalt – Berufskrankheiten – geringe Aufstiegs-/Umstiegsmöglichkeiten – Mangel an Anerkennung durch Gesellschaft & Medien – Verantwortung für unerfahrene Ehrenamtliche, Auszubildende, Praktikant*innen etc. – Missbrauch des Rettungssystems durch Anrufende – Konflikte mit anderen Berufsgruppen in Klinik, Heimen etc. – unklarer Kompetenzrahmen – unklare gesetzliche Absicherung | – ständig wechselnde Teamkollegen – schlechtes Arbeitsklima – Vorschriften und Dienstanweisungen – Bürokratie – Aus-/Fortbildung – Unterbezahlung – fehlende Erfolgsrückmeldung bzgl. Patient*innen |
Wichtig miteinzubeziehen ist auch der Bereich der Leitstellen, da dieser einige weitere spezifischere Stressoren mit sich bringt, auch wenn durch die räumliche, oft auch eine emotionalere Distanz zu Einsatzereignissen besteht. Sich ggf. schwerer auswirkende Situationen sind aber die nachfolgenden zu bedenken:
- Kollegen, Bekannte, Nachbarn etc. sind betroffen und man findet sich durch diese räumliche Distanz in einem starken Gefühl der Hilflosigkeit wieder.
- Einsatzkräfte schildern bei der Lagemeldung dramatische Szenen.
- Nicht alle Notrufe/Meldungen können von den anwesenden Mitarbeiter*innen zeitnah und umfassend bearbeitet werden.
- Während des Führens von Telefonaten mit den Bürger*innen kann es zu unbedachten Äußerungen kommen, welche ggf. auch durch die Sprachdokumentation spätere berufliche Konsequenzen haben können.
Was ist Resilienz?
Das Wort „Resilienz“ stammt aus dem Lateinischen und meint so viel wie „zurückspringen“ oder „abprallen“ und wurde zuerst in der Werkstoffkunde verwendet. Dort wurde der Begriff genutzt, um die Stoffeigenschaft des Zurückfindens eines Stoffes in die ursprüngliche Form nach Verformung durch Druck und Belastung von außen.
Den Begriff „Resilienz“ kann man von verschiedenen Seiten aus betrachten und definieren. Im Sinne der Psychologie ist die Resilienz die „Fähigkeit, sich von Trauma oder Stress zu regenerieren sowie positiv auf die Herausforderungen/Veränderungen zu reagieren“. Aus soziologischer Sicht beschreibt der Begriff Resilienz die „Fähigkeit von Gesellschaften, externe Störungen zu verkraften, ohne dass sich ihre wesentlichen Systemfunktionen ändern“. Eher aus technischer Betrachtungsweise ist Resilienz die „Fähigkeit von technischen Systemen, bei Störungen/Teil-Ausfällen nicht vollständig zu versagen, sondern wesentliche Systemdienstleistungen aufrechtzuerhalten“. Und schlussendlich versteht die Ökologie die Resilienz als die „Fähigkeit eines Ökosystems, bei Störungen seine grundlegende Organisationsweise zu erhalten, anstatt in einen anderen Systemzustand überzugehen“.
Aus sozio-psychologischer Sicht erfolgte eine standardisierte Definition des Begriffes 2005 auf dem internationalen Kongress „Resilienz – Gedeihen trotz widriger Umstände“ in Zürich, welche besagt, dass „Resilienz ist die Fähigkeit von Menschen, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen“.
Wichtige Einflussfaktoren zur Bewältigung von Trauma, Stress und Störung im Sinne der durch die American Psychological Association (APA) geprägten „Road to Resilience“ aus dem Jahr 2008 sind
- das Bemühen um soziale Beziehungen und die Sorge um sich selbst,
- eine optimistische Einstellung („Streben nach den eigenen Zielen auf dem Weg zu sich selbst“)
- die nüchterne Akzeptanz von Problemen und den eigenen Grenzen („Veränderung ist Teil des Lebens“),
- ein lösungsorientiertes Handeln („Krisen sind überwindbare Probleme“),
- das Verlassen der Opferrolle („Förderung eines positiven Selbstbildes“),
- die Übernahme von Verantwortung („Entschluss zum Handeln“),
- Netzwerkorientierung sowie
- Zukunftsplanung.
Mit diesen Attributen ist ein Grundstock gesetzt, um resilient zu handeln und nicht im Burn-Out oder an einer Trauma-Folgestörung zu erkranken.
Charakteristisch für die Resilienz ist, dass…
- diese nicht angeboren ist, sondern erlernt und trainiert werden kann.
- diese dynamisch ist, also Prägung dieser möglich ist und diese sich im zeitlichen Verlauf und im Kontext der Interaktion von Mensch und Umwelt entwickelt.
- diese variabel ist, was bedeutet, dass man einem bestimmten Zeitpunkt resilient sein kann und zu einem anderen Zeitpunkt wesentlich vulnerabler ist.
- diese situationsspezifisch ist, also die Resilienz ggü. einem bestimmten Stressor größer sein kann und es bei anderen Stressoren zu größeren Bewältigungsproblemen kann.
- diese multidimensional ist, was meint, dass man in einem Bereich gute Bewältigungskompetenzen hat und in anderen Bereichen dafür größere Anpassungsprobleme zeigt.
Was ist eine Posttraumatische Belastungsstörung? (6B40 ICD-11 WHO)
- Eine Posttraumatische Belastungsstörung entwickelt sich, wenn man einem extrem bedrohlichen oder entsetzlichen Ereignis oder einer Reihe von Ereignissen ausgesetzt war.
- Diese Ereignisse gekennzeichnet durch
- Wiedererleben des traumatischen Ereignisses oder der traumatischen Ereignisse in der Gegenwart in Form von lebhaften aufdringlichen Erinnerungen, Rückblenden oder Albträumen (Wiedererleben kann über eine oder mehrere Sinnesmodalitäten erfolgen und wird typischerweise von starken oder überwältigenden Emotionen, insbesondere Angst oder Entsetzen, und starken körperlichen Empfindungen begleitet)
- Vermeidung von Gedanken und Erinnerungen an das Ereignis bzw. die Ereignisse oder Vermeidung von Aktivitäten, Situationen oder Personen, die an das Ereignis bzw. die Ereignisse erinnern
- anhaltende Wahrnehmung einer erhöhten aktuellen Bedrohung, die sich z. B. durch Hypervigilanz oder eine verstärkte Schreckreaktion auf Reize wie unerwartete Geräusche zeigt (Symptome halten mindestens mehrere Wochen lang an und verursachen erhebliche Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen)
Was ist eine Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung? (6B41 ICD-11 WHO)
- Störung, die sich entwickeln kann, nachdem man einem Ereignis oder einer Reihe von Ereignissen extrem bedrohlicher oder schrecklicher Natur ausgesetzt war
- meist lang anhaltende oder sich wiederholende Ereignisse, denen man nur schwer oder gar nicht entkommen kann (z.B. Folter, Sklaverei, Völkermordkampagnen, lang anhaltende häusliche Gewalt, wiederholter sexueller oder körperlicher Missbrauch in der Kindheit)
- Es müssen alle diagnostischen Voraussetzungen für eine PTBS erfüllt sein sowie
- Probleme bei der Affektregulierung
- Überzeugungen über die eigene Person als vermindert, besiegt oder wertlos, begleitet von Scham-, Schuld- oder Versagensgefühlen im Zusammenhang mit dem traumatischen Ereignis
- Schwierigkeiten, Beziehungen aufrechtzuerhalten und sich anderen nahe zu fühlen
- Symptome führen zu erheblichen Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen
Was ist eine Anpassungsstörung? (6B43 ICD-11 WHO)
- maladaptive Reaktion auf einen identifizierbaren psychosozialen Stressor oder mehrere Stressoren (z.B. Scheidung, Krankheit oder Behinderung, sozioökonomische Probleme, Konflikte zu Hause oder am Arbeitsplatz), die normalerweise innerhalb eines Monats nach dem Stressor auftritt
- Störung ist gekennzeichnet durch die Beschäftigung mit dem Stressor oder seinen Folgen, einschließlich übermäßiger Sorgen, wiederkehrender und beunruhigender Gedanken über den Stressor oder ständiges Grübeln über seine Auswirkungen, sowie durch ein Versagen bei der Anpassung an den Stressor, das erhebliche Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen verursacht
- Symptome lassen sich nicht besser durch eine andere psychische Störung erklären (z.B. Stimmungsstörung, eine andere spezifisch mit Stress assoziierte Störung) und klingen in der Regel innerhalb von sechs Monaten ab, es sei denn, der Stressor hält länger an
Was ist eine Akute Belastungsreaktion? (QE84 ICD-11 WHO)
- Entwicklung vorübergehender emotionaler, somatischer, kognitiver oder verhaltensbezogener Symptome als Folge der Exposition gegenüber einem Ereignis oder einer Situation (entweder kurz- oder langfristig) extrem bedrohlicher oder schrecklicher Natur (z.B. Natur- oder von Menschen verursachte Katastrophen, Kampfhandlungen, schwere Unfälle, sexuelle Gewalt, Übergriffe)
- Symptomen können autonome Anzeichen von Angst (z.B. Tachykardie, Schwitzen, Erröten), Benommenheit, Verwirrung, Traurigkeit, Angst, Wut, Verzweiflung, Überaktivität, Inaktivität, sozialer Rückzug oder Stupor sein
- Reaktion auf Stressfaktor wird angesichts der Schwere des Stressfaktors als normal angesehen und beginnt in der Regel innerhalb weniger Tage nach dem Ereignis oder nach Entfernung aus der bedrohlichen Situation abzuklingen
Phasen einer Akuten Belastungsreaktion
- ABR – peritraumatische Phase (Akutphase)
- Gefühl des Betäubtseins sowie dissoziative Symptome (Depersonalisation & Derealisation)
- wichtige Aspekte der Situation nicht bemerkt („Tunnelblick“)
- Durchführung völlig sinnlos erscheinender Handlungen
- starke emotionale Schwankungen (Wut, Gereiztheit, Aggressivität, die nur schwer kontrollierbar sind)
- vegetative Reaktionen wie Schwitzen und Herzrasen
- ABR – Verarbeitungsphase (nach Einsatzende)
- Intrusionen (wiederkehrende Sinneseindrücke wie Bilder, Geräusche und Gerüche auch in Form von Alpträumen & Flashbacks)
- Reizvermeidung (Vermeidung von Gedanken, Gefühlen, Gesprächen, Orten und Personen, die irgendwie an das Ereignis erinnern)
- Hyperarousal (Angst & Übererregung, d.h. motorische Unruhe, Schreckhaftigkeit, Rückzug, Schlafstörungen, Konzentrationsmängel, Erinnerungslücken bzgl. Trauma, Gereiztheit, autodestruktives Verhalten, körperliche Symptome)
ggf. kommt es zu weiteren Symptomen, wie Gedächtnisstörungen, Selbstmedikation (auch Suchtmittelmissbrauch), anhaltende Depressionen, Benommenheit, Abstumpfung, Panikattacken/Angststörung sowie Phobien
Was ist Burnout? (QD85 ICD-11 WHO)
- Syndrom, das als Folge von chronischem Stress am Arbeitsplatz konzeptualisiert wird, der nicht erfolgreich bewältigt wurde
- gekennzeichnet durch drei Dimensionen:
- Gefühle der Energieerschöpfung oder Erschöpfung
- erhöhte mentale Distanz zur Arbeit oder Gefühle von Negativismus oder Zynismus in Bezug auf die Arbeit
- Gefühl der Ineffektivität und des Mangels an Leistung
- Burnout bezieht sich speziell auf Phänomene im beruflichen Kontext und sollte nicht zur Beschreibung von Erfahrungen in anderen Lebensbereichen verwendet werden
Wie gefährdet unsere Arbeit unsere eigene Gesundheit?
Die Arbeit in der Rettungs- und Notfallmedizin ist geprägt durch äußere und innere Einflüsse, die nicht gesund sind, und die Liste an Problemen ist unendlich, sodass nur ein grober Überblick über einige große Bereiche wie z.B. die Ernährung oder die Schichtarbeit möglich ist. Wir alle, egal ob Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei, Notaufnahme oder Intensivstation, sind im Rahmen unseres Dienstes mit menschlichen Schicksalen konfrontiert. Und diesen Schicksalen gilt es resilient gegenüberzutreten bzw. eine gute Resilienz aufzubauen, um diesen Schicksalen überhaupt ohne die Gefährdung von uns selbst entgegenzutreten. Diese Aufgabe liegt zum einen in unserem persönlichen Verantwortungsbereich, jedoch verpflichtet der Gesetzgeber die Arbeitgeber dazu, seine Fürsorgepflicht ernst- und wahrzunehmen und gemäß dem Arbeitsschutzgesetz die Arbeitsbedingungen zu beurteilen, um Gefährdungen auszumachen und diese zu beseitigen.
(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind.
§ 5 ArbSchG
(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend.
(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch
1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes,
2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,
3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit,
4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit und deren Zusammenwirken,
5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten,
6. psychische Belastungen bei der Arbeit.
Gemäß diesem gesetzlichen Auftrag hat jeder Betrieb eine Gefährdungsbeurteilung über die verschiedenen Belastungen bei der Arbeit im Rettungsdienst vorzunehmen und einen Maßnahmenkatalog zu erstellen, wie man diese Gefährdungen strukturiert minimiert. Schockierend in diesem Bezug ist, dass erst im Jahr 2013 bei der Novellierung des „Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit“ (Arbeitsschutzgesetz) die psychischen Einflussfaktoren in den Kanon der Gefährdungen aufgenommen worden sind. Unsere Arbeitgeber haben also kurz gesagt zwei Aufgaben oder Ziele bei der Realisierung gesundheitsförderlichen Arbeitens:
- Ressourcen schaffen, die die eigene Gesundheit fördern, schaffen bzw. ausbauen
- gesundheitliche Risiken vorbeugen bzw. reduzieren
Zahlen und Fakten
- mehr als 90 % des ärztlichen und nicht-ärztlichen Personals im Rettungsdienst berichten in Studien von Einsätzen, die Traumatisierungsrisiken bergen (v.a. Großschadenslagen mit einem Massenanfall an Verletzten, schwer verletzte oder getötete Kinder, erfolglose Reanimationen)
- PTBS-Prävalenz in der Intensiv- , Akut- und Notfallmedizin (Normalbevölkerung: 3 – 8 %)
- Rettungsdienstspersonal: 6 – 36 %
- Notärzte: ca. 16,8 %
- pflegerisches und ärztliches Personal auf Intensivstationen: 10 – 41 %
- Ausprägungen einzelner Symptome meist deutlich höher (82 – 88 % für Intrusionen, 80 % für Vermeidungsverhalten, 60 –75 % für Übererregung)
- Burn-out-Wahrscheinlichkeit in der Intensiv- , Akut- und Notfallmedizin
- 4,1 – 9 % bei Notärzten und Rettungsdienstmitarbeiter*innen
- 55,6 % bei pflegerischem und ärztlichem Personals der Notaufnahmen
- 30 % beim pflegerischen und 20 – 50 % beim ärztlichen Personal der Intensivstationen
- 13,7 % des medizinischen Rettungsdienstpersonals in Deutschland berichteten laut RKI, in den vergangenen zwölf Monaten von einer depressiven Erkrankung (ca. 50 % mehr als in der Normalbevölkerung), wobei die Wahrscheinlichkeit bei Männern sogar dreimal häufiger ist
- 54,1 % der Berufsfeuerwehrleute bezeichnen in einer Umfrage ihren Wachalltag als „psychisch belastend“ und 51,4 % sind mit ihrem Wachalltag „eher unzufrieden“, was v.a. an den bis zu 70 % einsatzfreie Bereitschaftszeit liegt, welche mit einer hohen Belastung aufgrund der ständigen inneren Anspannung/Ungewissheit, der Unterforderung durch die Wachenaufgaben sowie aufgrund unerfüllter Erwartungen
- 42,9 % der Berufsfeuerwehrleute urteilen sogar, dass die Arbeitszeit, die sie auf der Wache verbringen, belastender ist als die Einsatzzeit.
- in Untersuchungen gaben 100 % aller befragten Notärzt*innen die Belanglosigkeit des Notfalleinsatzes als Belastungsfaktor; 55 % der Notärzt*innen fühlten sich dadurch „mittel“ und 20 % „stark“ beansprucht
- ca. 40 % der Notärzt*innen fehlte häufig bzw. zumindest gelegentlich die Kraft für die Freizeitgestaltung
- 81 % der befragten Notärzt*innen gaben die erhöhte Dokumentation als Belastungsfaktor an
- Fehlzeiten der Einsatzkräfte im Rettungsdienst liegen bei 7,14 % also 26,04 Fehltagen (bundesdeutschen Durchschnitt von 4,23 % also 15,43 Fehltagen)
- Erhebungen zu oft genannten physischen Belastungsfaktoren im Feuerwehr- & Rettungsdienst
- ungünstige Körperhaltung (73,3 %)
- Heben (70,7 %) und Tragen (69,3 %) schwerer Lasten
- körperliche Arbeit (65,8 %)
- Halten schwerer Lasten (59,6 %)
- Ziehen/Schieben schwerer Lasten (55,1 %)
- Wärme/Hitze (41,3 %)
Ernährung
Das Thema „Ernährung“ spielt in allen Lebensbereichen eine wichtige Rolle, aber vor allem in Berufen mit nicht klar geregelten Pausen und Schichtarbeit ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung von besonderer Relevanz. Die gilt das alte, aber immer noch bestehende Motto „Wer rettet, der fettet!“. In diesen Zusammenhang belegen zahlreiche Studien, dass die Ernährung einen erheblichen Einfluss auf die Morbidität verschiedener Erkrankungen hat. Eine schlechte Ernährung steht zudem geschlechtsunabhängig auf Platz 1 der Ursachen für den Verlust gesunder Lebensjahre.
Schneider et al. (2022) konnten in einer Arbeit nachweisen, dass der Verzehr von Gemüse, Obst, Vollkornprodukten sowie Milch und Milchprodukten im Rettungsdienst unter den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) liegen und im Gegenzug lag der Verzehr von ungesunden Lebensmittel (hoher Energiegehalt und/oder ungünstiges Nährstoffprofil) wie Fast Food, Süßigkeiten, Knabberartikel und zuckergesüßte Getränke sowie von Fleisch und Wurst stark über den Richtwerten der DGE. Damit hat nur 1/5 der Rettungsdienstler*innen ein günstiges Ernährungsmuster. Weiter konnte festgestellt werden, dass nur 31,8 % der Befragten fest Pausenzeiten hatten, aber nur 13,1 % schafften es „oft“ oder „immer“ auf der Rettungswache frische Speisen zuzubereiten, wohin gehend etwa 42,2 % auf der Wache „immer“ bzw. „oft“ verzehrfertig gekaufte Speisen gegessen haben. Bei der Frage nach Gründen für den Ausfall von Mahlzeiten waren vor allem in 40,1 % der Fälle berufsbedingte Faktoren wie Einsätze, Arbeits- und Pausenzeiten sowie in 33,1 % allgemeine Faktoren wie Schlaf und Stress ausschlaggebend.
DGE-Ernährungsempfehlungen
Die Ernährungsempfehlungen der DGE untergliedern sich in drei Bereiche. Dies sind zum einen die nachfolgenden 10 Regeln für vollwertiges Essen und Trinken:
- 1. Lebensmittelvielfalt genießen: Nutzen Sie die Lebensmittelvielfalt und essen Sie abwechslungsreich. Wählen Sie überwiegend pflanzliche Lebensmittel.
- 2. Gemüse und Obst – nimm „5 am Tag“: Genießen Sie mindestens 3 Portionen Gemüse und 2 Portionen Obst am Tag. Zur bunten Auswahl gehören auch Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen und Bohnen sowie (ungesalzene) Nüsse.
- 3. Vollkorn wählen: Bei Getreideprodukten wie Brot, Nudeln, Reis und Mehl ist die Vollkornvariante die beste Wahl für Ihre Gesundheit.
- 4. Mit tierischen Lebensmitteln die Auswahl ergänzen: Essen Sie Milch und Milchprodukte wie Joghurt und Käse täglich, Fisch ein- bis zweimal pro Woche. Wenn Sie Fleisch essen, dann nicht mehr als 300 bis 600 g pro Woche. (Wer viel rotes Fleisch und Wurst isst, hat ein höheres Risiko für Darmkrebs. Für weißes Fleisch besteht nach derzeitigem Wissensstand keine Beziehung zu Krebserkrankungen.)
- 5. Gesundheitsfördernde Fette nutzen: Bevorzugen Sie pflanzliche Öle wie beispielsweise Rapsöl und daraus hergestellte Streichfette. Vermeiden Sie versteckte Fette. Fett steckt oft „unsichtbar“ in verarbeiteten Lebensmitteln wie Wurst, Gebäck, Süßwaren, Fast-Food und Fertigprodukten.
- 6. Zucker und Salz einsparen: Mit Zucker gesüßte Lebensmittel und Getränke sind nicht empfehlenswert. Vermeiden Sie diese möglichst und setzen Sie Zucker sparsam ein. Sparen Sie Salz und reduzieren Sie den Anteil salzreicher Lebensmittel. Würzen Sie kreativ mit Kräutern und Gewürzen. (Zu viel Salz im Essen kann den Blutdruck erhöhen. Mehr als 6 g am Tag sollten es nicht sein. Wenn Sie Salz verwenden, dann angereichert mit Jod und Fluorid.)
- 7. Am besten Wasser trinken: Trinken Sie rund 1,5 Liter jeden Tag. Am besten Wasser oder andere kalorienfreie Getränke wie ungesüßten Tee. Zuckergesüßte und alkoholische Getränke sind nicht empfehlenswert.
- 8. Schonend zubereiten: Garen Sie Lebensmittel so lange wie nötig und so kurz wie möglich, mit wenig Wasser und wenig Fett. Vermeiden Sie beim Braten, Grillen, Backen und Frittieren das Verbrennen von Lebensmitteln.
- 9. Achtsam essen und genießen: Gönnen Sie sich eine Pause für Ihre Mahlzeiten und lassen Sie sich Zeit beim Essen. (Langsames, bewusstes Essen fördert den Genuss und das Sättigungsempfinden. Das Sättigungsgefühl tritt erst ca. 15 bis 20 Minuten nach Beginn der Mahlzeit ein. Wer zu schnell isst, kann gar nicht bemerken, dass er vielleicht schon genug gegessen hat.)
- 10. Auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben: Vollwertige Ernährung und körperliche Aktivität gehören zusammen. Dabei ist nicht nur regelmäßiger Sport hilfreich, sondern auch ein aktiver Alltag, indem Sie z. B. öfter zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren. (Pro Tag 30 bis 60 Minuten moderate körperliche Aktivität fördern Ihre Gesundheit und helfen Ihnen dabei, Ihr Gewicht zu regulieren.)
Der zweite Bereich der DGE-Ernährungsempfehlungen ist der DGE-Ernährungskreis, welcher die Nahrungsmittel in die folgenden sieben Gruppen unterteilt (Reihenfolge der ersten sechs Punkte entspricht der Priorisierung der Wichtigkeit und der gesundheitstechnischen Aspekte):
- Getreide, Getreideprodukte und Kartoffeln
- Gemüse und Salat
- Obst
- Milch und Milchprodukte
- Fleisch, Wurst, Fisch und Eier
- Öle und Fette
- Getränke, welche das Zentrum des DGE-Ernährungskreises ausmachen
Der dritte und letzte Bereich ist die dreidimensionale DGE-Lebensmittelpyramide. Diese verknüpft die quantitativen mit qualitativen Aussagen der vorherigen Modelle und veranschaulicht so die Prinzipien einer vollwertigen Ernährung.
Des Weiteren sollte man auf eine ausreichende körperliche Aktivität bzw. Sport achten. Empfohlen sind täglich durchschnittlich 30 – 60 Minuten. Darauf angepasst, sollte der Energiegehalt der Nahrung bedarfsgerecht sein. Es gilt die Grundformel…
(Ruhe-)Grundumsatz von 1 Kilokalorie (kcal) pro Kilogramm (kg) Normal-Körpergewicht (KG) pro Stunde, was beispielsweise bei einem 70-kg-Standard-Menschen folgende Rechnung ergibt: 1 x 70 x 24 = 1.680 kcal Ruhebedarf pro Tag
Bei leichter körperlicher Aktivität sollte man ein Drittel hinzurechnen, für mittlere Belastungen (z.B. Beispiel: 1 h lockeres Laufen) zwei Drittel, bei hohem Aktivitätslevel das Doppelte des Ruheumsatzes. 50 – 60 % davon sollten Kohlenhydraten, 10 -15 % Eiweiß (ca. 0,8 – 1 g Protein/kg/d) und 25 – 30 % Fettsäuren (hochwertige Fette, i.d.R. pflanzlichen Ursprungs) sein. Der Polysaccharid-Anteil sollte höher als der von Einfachzuckern sein, deshalb eher Obst bevorzugen. Bei Fleisch und Wurst wird eine wöchentliche Menge von 300 bis 600 g fettarmen, unverarbeiteten Fleisches bzw. Wurst empfohlen.
Exkurs „Suchtmittel-Konsum“
Bzgl. des Konsums sei auf den Blog-Beitrag „Exkurs zu Suchtproblemen bei medizinischem Personal zum Internationalen Tag gegen Drogenmissbrauch und unerlaubten Suchtstoffverkehr“ verwiesen. Kurz zusammengefasst lässt sich aber konstatieren, dass die Arbeit im Rettungsdienst mit einem erhöhten Risiko für Abhängigkeitserkrankungen jeglicher Art aufgrund berufsbedingter psychischer und physischer Belastungen assoziiert ist, auch aufgrund der relativ leichten Zugänglichkeit und Vertrautheit mit psychotropen Substanzen.
In diesem Bezug erscheint es wichtig, vor allem auch die Richtwerte für einen risikoarmen Alkoholkonsum hervorzuheben. Diese liegen bei Frauen bei nicht mehr als einem und bei Männern bei nicht mehr als zwei Standardgläsern Alkohol pro Tag. Zusätzlich sollte an min. zwei Tagen pro Woche auf Alkohol verzichtet werden. Die Definition eines Standardglases (also 10 – 12 Gramm reiner Alkohol) sieht hierbei wie folgt aus
- Bier (5 Vol-%: 0,3 L)
- Wein (12 Vol-%: 0,125 L)
- Sekt (12 Vol-%: 0,1 L)
- Schnaps (35 Vol-%: 4 cL)
Wichtig zu betonen ist, dass die gleiche Menge Alkohol bei Frauen deshalb führt zu einem höheren Alkoholgehalt im Blut.
Auch die Raucherquote im Gesundheitswesen ist mit bis zu 45 % höher als in der Normalbevölkerung. Im Mittel wurden bei einer
Schichtarbeit
Der Stressor „Schichtarbeit“ hat große Auswirkungen auf die körperliche und mentale Gesundheit und viele der Folgen sind nur schwer und spät abzusehen. Aus diesem Grund hat auch das Bundesverfassungsgericht 1992 (1 BvR 1025/84) Nachtarbeit als ungesund und schädlich befunden.
Nachtarbeit ist grundsätzlich für jeden Menschen schädlich. Sie führt zu Schlaflosigkeit, Appetitstörungen, Störungen des MagenDarmtraktes, erhöhter Nervosität und Reizbarkeit sowie zu einer Herabsetzung der Leistungsfähigkeit
BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 28. Januar 1992
– 1 BvR 1025/84 -, Rn. 1-72,
http://www.bverfg.de/e/rs19920128_1bvr102584.html
Ein Blick in die S2k-Leitlinie „Gesundheitliche Aspekte und Gestaltung von Nacht- und Schichtarbeit“ (Zusammenfassung HIER bei FOAMio) zeigt, welche Auswirkungen die Schicht- und Nachtarbeit hat. Folgende wichtigen Aspekte sind wichtig für die Bewertung der Gesundheitsschädlichkeit:
- Schlafstörungen und/oder eine ausgeprägte Tagesmüdigkeit /Fatigue oder Tagesschläfrigkeit in zeitlichem Zusammenhang mit Schichtarbeit (Schichtarbeit-Störung bzw. „Schichtarbeitersyndrom“)
- Konzentrationsschwierigkeiten, Fehlernhäufung und Unfällen
- negative Beeinflussung von Familien- und Sozialleben in besonderer Weise
- allgemeine Abgeschlagenheit, Schwächegefühl, Appetitlosigkeit, Reizbarkeit, Schwindel, Obstipation, abdominelle Koliken, Brechreiz oder Erbrechen sowie Lähmung peripherer motorischer Nerven
- negative Auswirkung auf Blutbildung
- neurotoxische Wirkungen (reduzierte Nervenleitgeschwindigkeit peripherer Nerven)
- erhöhtes Risiko für Herz- und Gefäßerkrankungen durch entzündliche Veränderungen, Veränderungen der Blutgerinnung, Aktivierung des sympathischen Nervensystems und Anstieg des Blutdrucks
- gestörte Glukosetoleranz und Insulinresistenz
- erhöhtes Risiko eines Metabolischen Syndroms (Auftreten von vier metabolischen Veränderungen: gestörte Glukosetoleranz bzw. Insulinresistenz, viszerale/abdominelle Fettleibigkeit/stammbetonte Adipositas, Fettstoffwechselstörung mit erniedrigtem HDL-Cholesterin und Hypertriglyzeridämie und Hypertonie)
- erhöhtes Risiko für Gastritis und Ulcuserkrankungen, aber auch entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn
- erhöhtes Risiko für psychiatrisch-affektive Symtomatik
- erhöhtes Risiko für primäre Kopfschmerzerkrankungen (Migräne, Spannungskopfschmerzen, Clusterkopfschmerzen u.a.), trigeminoautonome Kopfschmerzen und Gefahr der Chronifizierung bestehender episodischer Kopfschmerzen sowie erhöhtes Risiko für Epilepsie; bei massiver Exposition ggf. Enzephalopathie
- erhöhtes Krebsrisiko
- negative Auswirkungen auf intime Beziehungen, Sexualverhalten sowie auf Fruchtbarkeit
- negative Konsequenzen auf das Wachstum eines Fötus und auf den Zeitpunkt der Entbindung sowie erhöhtes Risiko für Frühgeburt
Aus diesen Befunden resultieren v.a. die nachfolgenden, wichtigsten Empfehlungen der S2K-Leitlinie:
- keine Ruhezeiten unter 11 Stunden
- Angebot edukative Maßnahmen hinsichtlich schlafstörender und schlaffördernder Verhaltensweisen
- bei vorhandenen moderaten und schweren Insomnien mit entsprechender Beeinträchtigung der Wachbefindlichkeit Wechsel in Tagschicht oder geeignete kontinuierliche Schicht bis zur Remission
- Wechsel in Tagschicht für Personen
- mit schweren schlafbezogenen Atmungsstörung mit ausprägten komorbiden Stoffwechsel- und HerzKreislauf-Erkrankungen
- mit schwerem oder schwer behandelbaren RestlessLegs-Syndrom
- Betroffene mit schwerer und/oder schlecht behandelbarer Parasomnie
- keine Schichtarbeit für Personen mit Narkolepsie oder auch Personen mit altersbedingten Schlafstörungen
- Nachtarbeit auf Minimum begrenzen, um Konzentrationsschwierigkeiten, Fehlern und Unfällen vorzubeugen
- Beteiligung der Beschäftigten an Schichtplangestaltung
- Prävention von KHK, Diabetes mellitus Typ 2 und metabolischem Syndrom durch:
- vorwärts rotierende Schichten
- schnell rotierende Schichten
- Vermeidung bzw. Eingrenzung von konsekutiven Nachtschichten (maximal 3 Nächte hintereinander)
- Vermeidung von Wochenendschichten
- Vorhersagbarkeit der Schichtpläne
- individuelle Einflussnahme auf die Schichtplangestaltung
- aufgrund des möglicherweise moderierenden Einflusses psychosozialer Belastungen durch die Arbeit sollten diese besonders berücksichtigt werden
- Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung sollte speziell auch die Bedingungen der Nachtschichtarbeit einschließen
- Schichtarbeit sollte bei Patientinnen und Patienten mit nachgewiesener Zunahme der Kopfschmerzhäufigkeit und -intensität aufgrund von schichtbedingten Schlafunregelmäßigkeiten möglichst gering gehalten und ergonomisch gestaltet werden
Statistiken zu gesundheitliche Auswirkungen
Die Auswirkungen der Stressoren und belastenden Ereignisse sind mannigfaltig. Tracogna et al. konnten 2003 in einer Befragung von Pflegepersonal in Krankenhäusern folgende selbstberichtete Beschwerden innerhalb der letzten 12 Monaten ausmachen:
- Kreuz- und Rückenschmerzen (55,1 %)
- Nacken- und Schulterschmerzen (51,0 %)
- Kopfschmerzen (38,8 %)
- Konzentrationsstörungen (28,6 %)
- Nervosität und Unruhe (26,5 %)
- Unterleibsschmerzen (24,5 %)
- Stimmungsschwankungen (24,5 %)
- Herzrasen, Kreislaufbeschwerden und Schwindel (22,4 %)
- Schlafstörungen (20,4 %)
- Magenschmerzen und Sodbrennen (14,2 %)
- Verstopfung (14,3 %)
- Durchfall (10,2 %)
- depressive Verstimmungen (12,2 %)
- Alpträume (6,9 %)
Darüber hinaus berichteten die Befragten von folgenden Krankheiten innerhalb der letzten 12 Monaten:
- Nasennebenhöhlenentzündung (47,0 %; bei dieser hohen Rate wird ggf. ein Zusammenhang mit berufsbedingten Desinfektionsmittelinhalationen bzw. Allergien angenommen)
- Fieber (46,7 %)
- Herpesinfektion im Mund- und Nasenbereich (38,7 %)
- Erkrankungen des Bewegungsapparates (32,6 %)
- Migräne (22,0 %)
- Heuschnupfen (25,0 %)
- Hausstauballergie (14,3 %)
- Tierallergie (12,4 %)
- Bronchitis (16,4 %)
- Blasen- und Nierenerkrankungen (14,3 %)
- Schilddrüsenerkrankungen (12,3 %)
- Magenschleimhautentzündung (12,2 %)
- Bluthochdruck (10,2 %)
Lösungsansätze zur Gesundheitsförderung & Maßnahmen der Prävention (Betriebliches Gesundheitsmanagement)
Zu unterscheiden sind die Lösungsansätze in die eigenverantwortlichen und betrieblichen Ansätze, wobei es hier im Sinne der Aufklärung und Prävention durch den Arbeitgeber zu Überschneidungen kommen kann. Das große Schlagwort ist hierbei „Betriebliches Gesundheitsmanagement“. Mit diesem kann man die arbeitsbedingten Fehlzeiten, welche in Deutschland bei ca. 44 Mrd. Euro liegen, um bis zu 26 % reduzieren und somit Belastungen verringern und die Arbeitszufriedenheit und –motivation steigern. Betriebliches Gesundheitsmanagement als Idee und Ansatz gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten. Bereits 1986 hat die WHO die „Ottawa Charta“ verabschiedet, in welcher Arbeitsorganisation, Rahmenbedingungen für die zu leistende Arbeit und der Stellenwert der Gesunderhaltung der Mitarbeiter*innen zentrales Thema ist. Im Jahr 1997 wurde die „Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung“ der EU verabschiedet, welche nochmals vertiefend auf die nachhaltige und ganzheitliche Konzeptionierung im betrieblichen Gesundheitsmanagement eingeht.
Eigenverantwortliche Ansätze zur Förderung der Gesundheit wären z.B.
- Warm-up zu Dienstbeginn (Körper auf „Betriebstemperatur“ bringen, um muskuloskelettale Verletzungen zu verhindern)
- Bewegungspausen zur Vorbeugung von Bewegungsmangel
- präventives Sporttreiben in der Freizeit oder sofern möglich auf der Wache
- Nutzung von Arbeitshilfen wie Schleiftuch, Drehleiter anstatt mehrere Stockwerke tragen, Rollbretter bei der Umlagerung etc.
- diensttaugliche Mahlzeiten, ggf. auch in Form von ausgewogenem „Meal-Prepping“
- Herstellen von Handlungssicherheit zur Reduktion mancher psychischer Belastungen durch Beherrschen von Algorithmen, Handgriffe und der Umgang mit Geräten sowie Technik sowie regelmäßige Fortbildung
- Wochenplanung zur Vereinbarkeit von Freizeit bzw. Familie und Beruf
Zu den betrieblichen Ansätzen, also dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement, gehören z.B.
- Arbeits- und Gesundheitsschutz, worunter z.B. die Bereiche Betriebssicherheit, Lärm- und Vibrationsarbeitsschutz, Benutzung der persönlichen Schutzausrüstung, Lastenhandhabung, Bildschirmarbeit fallen
- Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM), was darauf abzielt Beschäftigte, die länger als 6 Wochen krank waren, vorsichtig wieder an ihrem Arbeitsplatz einzugliedern, die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten und Frühverrentung oder Arbeitslosigkeit zu vermeiden
- Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) bestehend aus Verhältnis- & Verhaltensprävention
- Verbesserung von Arbeitsbedingungen, Betriebsklima und Arbeitskultur
- Förderung des Wir-Gefühls
- Konfliktlösung zusammen mit Betriebsrat und Geschäftsführung
- Vermeidung von Unter- bzw. Überforderung
- gesunde und wertschätzende Führungskultur
- Betriebsvereinbarungen zu Mobbing, Konflikten, Maßnahmen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie usw.
- transparente Informations- und Kommunikationspolitik
- Personalmanagement
- z.B. generations- und altersspezifische Potenziale der Mitarbeiter*innen berücksichtigen
- Berücksichtigung individuelle Potenziale und Stärkung der persönlichen Ressourcen der Mitarbeiter*innen
- Schaffung eines hohen Leistungspotenzials durch Lebensqualität
- Nachhaltigkeit schaffen und keine Abwägung zwischen betrieblichem Gesundheitsmanagement und betrieblicher Einsparmaßnahmen
Konkrete, präventive Aspekte der BGF wären z.B. die Schaffung rauchfreier Bereiche oder von Fitnessräumen-/angeboten, Angebote für eine gesündere Ernährung wie z.B. durch wöchentliche Obstkörbe o.Ä., Fortbildungen zu Themen der Gesundheitsprävention, regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, regelmäßige Gefährdungsbeurteilungen zur Minimierung von Gefahren, Ermittlung psychischer Belastungen oder Prävention solche durch Angebote wie die PSNV-E sowie z.B. auch flexiblere Arbeitszeitmodelle.
Einsatznachbereitung bei traumatischen Einsätzen
Sollte eine Einsatznachbereitung nach belastenden und/traumatischen (Groß-)Einsätzen nötig und möglich sein, ist das Vorgehen in einzelnen Phasen sinnvoll. Eine mögliche Form wäre die nachfolgende:
- Phase 1 – Demobilisation (strukturiertes Einsatzende)
- unmittelbar nach Einsatz
- Stressabbau, Beginn der Erholungsphase
- für Großgruppen, also alle Einsatzbeteiligten, angedacht
- kurze Informationsphase über Einsatzlage um den gleichen Informationsstand zu schaffen (10 – 20 min)
- Imbiss / Erfrischungen
- Phase 2 – Defusing (Einsatzkurzbesprechung)
- 6 – 12 h nach Ereignis (vor der 1. Nacht!)
- Reduktion von Belastungen, Stärkung der Gruppe, Austausch von Information, Emotionale Last erleichtern
- Austausch der Einsatzkräfte und Informationen in Kleingruppen, ggf. wachen- oder fahrzeugspezifisch (20 – 45 min)
- Phase 3 – Debriefing (Einsatznachbesprechung)
- 3 – 10 Tage nach Ereignis oder 3 – 6 Wochen nach Katastrophe
- gleich wie Defusing, nur ausführlicher (CAVE: auf freiwilliger Basis!)
- Einführung, Tatsachen, Gedanken, Emotionen, Reaktionen, Informationen, Abschluss (in Kleingruppen; Dauer: ca. 1 – 3 h)
Quellen
- International Classification of Diseases, Eleventh Revision (ICD-11), World Health Organization (WHO) 2019/2021 https://icd.who.int/browse11
- Armgart, C. Notfallsanitäter heute. Herausgegeben von Jürgen Luxem, Klaus Runggaldier, Harald Karutz, Frank Flake, Alex Lechleuthner, und Dietmar Kühn. 6., neu Konzipierte und Komplett überarbeitete Auflage. München: Elsevier, 2016.
- Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und und Wohlfahrtspflege. „Betriebliches Gesundheitsmanagement“. Sicherer Rettungsdienst, 1. Mai 2021. https://www.sicherer-rettungsdienst.de/rettungswache/zugehoerige-themen/betriebliches-gesundheitsmanagement.
- Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. „Psychosoziale Unterstützung“. Sicherer Rettungsdienst, 1. November 2021. https://www.sicherer-rettungsdienst.de/rettungswache/zugehoerige-themen/psychosoziale-unterstuetzung.
- Böckelmann, Irina, Beatrice Thielmann, und Heiko Schumann. „Psychische und körperliche Belastung im Rettungsdienst: Zusammenhang des arbeitsbezogenen Verhaltens und der Beanspruchungsfolgen“. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 65, Nr. 10 (Oktober 2022): 1031–42. https://doi.org/10.1007/s00103-022-03584-1.
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, und Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. „Alkoholkonsum – Kenn dein Limit: Alkohol? Kenn dein Limit.“ Zugegriffen 24. Juli 2023. https://www.kenn-dein-limit.de/alkoholkonsum/.
- Cajoos, Vera, und Iseut von Tavel. „Fokus Rettungsdienst – Resilienz und Kohärenzgefühl von Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitätern aus der Deutschschweiz“. Zürcher Fachhochschule für angewandte Wissenschaften, 2017. https://sbap.ch/wp-content/uploads/2017/06/AO_2017F_Cajoos_Veravon-Tavel_Iseut_6.0.pdf.
- Christiansen, Jens. „Resilienz & Leitstelle“. Gehalten auf der Symposium Leitstelle aktuell, Bremerhaven, 10. Mai 2022. https://www.symposium-leitstelle.de/wp-content/uploads/2022/05/004_Leitstelle2022-Resilienz_Christiansen.pdf.
- Cortes, Carmen, Irina Böckelmann, und Heiko Schumann. „Risikofaktor Schichtsystem: Zur Schlafqualität im Rettungsdienst“. Rettungsdienst – Zeitschrift für präklinische Notfallmedizin 42, Nr. 11 (2019): 1044–49.
- Darius, Sabine, Benjamin Balkaner, und Irina Böckelmann. „Arbeitsbelastungen bei Notärzten: Welche gesundheitlichen Folgen drohen?“ Rettungsdienst – Zeitschrift für präklinische Notfallmedizin 43, Nr. 4 (2020): 340–45.
- Darius, Sabine, Heiko Schumann, Benjamin Balkaner, und Irina Böckelmann. „Gefährdungen und Arbeitsschutzmaßnahmen im Rettungsdienst: Was müssen Einsatzkräfte wissen?“ Rettungsdienst – Zeitschrift für präklinische Notfallmedizin 42, Nr. 11 (2019): 1038–43.
- Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V., Hrsg. „S2k-Leitlinie ‚Gesundheitliche Aspekte und Gestaltung von Nacht- und Schichtarbeit‘“, 31. Oktober 2020. https://register.awmf.org/assets/guidelines/002-030l_S2k_Gesundheitliche-Aspekte-Gestaltung-Nacht-und-Schichtarbeit_2020-03.pdf.
- Deutsche Gesellschaft für Ernährung. „DGE-Ernährungskreis“. Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Zugegriffen 24. Juli 2023. http://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/dge-ernaehrungsempfehlungen/dge-ernaehrungskreis/.
- Deutsche Gesellschaft für Ernährung. „Dreidimensionale DGE-Lebensmittelpyramide“. Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Zugegriffen 24. Juli 2023. https://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/dge-ernaehrungsempfehlungen/dreidimensionale-dge-lebensmittelpyramide/.
- Deutsche Gesellschaft für Ernährung. „Vollwertig essen und trinken nach den 10 Regeln der DGE“. Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Zugegriffen 24. Juli 2023. http://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/dge-ernaehrungsempfehlungen/10-regeln/.
- Dix, Katharina, und Jörg Kiewer. „Gesundheitsförderung im RD: Welche Belastungen wirken auf die Mitarbeiter ein?“ Rettungsdienst – Zeitschrift für präklinische Notfallmedizin 32, Nr. 11 (2009): 1052–56.
- Faltermaier, Toni. „Salutogenese“. Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, 2023, Strategien und Methoden. https://doi.org/10.17623/BZGA:Q4-I104-3.0.
- Holtz, Maik, und Stephan Korupp. „Mal schnell was essen – Ernährung im Rettungsdienst“. retten! 3, Nr. 01 (25. Februar 2014): 14–17. https://doi.org/10.1055/s-0034-1370393.
- International Classification of Diseases, Eleventh Revision (ICD-11), World Health Organization (WHO) 2019/2021 https://icd.who.int/browse11
- ISF. „What Is Self-Care?“ Zugegriffen 23. Juli 2023. https://isfglobal.org/what-is-self-care/.
- Karutz, Harald, und Verena Blank-Gorki. „Psychische Belastungen und Bewältigungsstrategien in der präklinischen Notfallversorgung“. Notfallmedizin up2date 9, Nr. 04 (13. Januar 2015): 355–74. https://doi.org/10.1055/s-0033-1358063.
- Karutz, Harald, Mark Overhagen, und Janna Stum. „Psychische Belastungen im Wachalltag von Rettungsdienstmitarbeitern und Feuerwehrleuten“. Prävention und Gesundheitsförderung 8, Nr. 3 (August 2013): 204–11. https://doi.org/10.1007/s11553-012-0373-y.
- Kluge, Stefan, Matthias Heringlake, Uwe Janssens, und Bernd Böttiger, Hrsg. DIVI Jahrbuch 2019/2020: Fortbildung und Wissenschaft in der interdisziplinären Intensivmedizin und Notfallmedizin. 1. Auflage. DIVI Jahrbuch 9. Berlin: MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2020.
- Leonhardt, Marion. „Belastungen im Rettungsdienst“. Ver.di – Gesundheit, Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft, 27. Juli 2017. https://gesundheit-soziales-bildung.verdi.de/mein-arbeitsplatz/rettungsdienst/++co++bb73e85e-712f-11e7-b651-525400afa9cc.
- Luthiger-Stocker, Daniela. „Stress und Resilienz in der Notfallpflege – Stressoren und Ressourcen“. WE’G Weiterbildungszentrum für Gesundheitsberufe, 30. August 2008. https://www.notfallpflege.ch/files/_Demo/Dokumente/Schriftliche_Arbeiten/Stress_und_Resilienz_D_Luthinger_Stocker.pdf.
- Medical School Hamburg, Ines Pfeffer, und Britta Wulfhorst. „Analyse der Arbeitsbelastung bei Mitarbeitern des Rettungsdienstes – Ableitung von Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung“. Medical School Hamburg. Zugegriffen 23. Juli 2023. https://www.medicalschool-hamburg.de/forschung-institute-labs/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/analyse-der-arbeitsbelastung-bei-mitarbeitern-des-rettungsdienstes-ableitung-von-massnahmen-der-praevention-und-gesundheitsfoerderung/.
- Müller, R., M. Steil, und C. Schneider. „Psychohygiene für Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz“. FRRP – Fortbildung Rettungsdienst Rheinland Pfalz, 18. Juli 2017. https://www.bildungsinstitut-rlp.drk.de/fileadmin/downloads/Jaehrliche_Fortbildungen_im_RD/2017/Psychohygiene_u__berarbeitet_2017-07-03.pdf.
- Neumayr, Agnes, Michael Baubin, und Adolf Schinnerl, Hrsg. Herausforderung Notfallmedizin: Innovation – Vision – Zukunft. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56627-5.
- Neumayr, Agnes, Michael Baubin, und Adolf Schinnerl, Hrsg. Zukunftswerkstatt Rettungsdienst: Innovative Projekte im Rettungs- und Notarztwesen. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56634-3.
- Nieden, Martin zur. „DFV_Erste_Hilfe_kompakt_Ernaehrung.pdf“. Deutscher Feuerwehrverband, 1. April 2016. https://www.feuerwehrverband.de/app/uploads/2020/05/DFV_Erste_Hilfe_kompakt_Ernaehrung.pdf.
- Redaktion Deutsches Ärzteblatt. „Psychische Gesundheit: Angebot für Rettungskräfte“. Deutsches Ärzteblatt, 21. September 2022. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/137574/Psychische-Gesundheit-Angebot-fuer-Rettungskraefte.
- Rielage, Thomas, Verena Blank-Gorki, und Harald Karutz. „Wenn das Stressfass überläuft: Umgang mit psychischen Belastungen im Einsatz“. Rettungsdienst – Zeitschrift für präklinische Notfallmedizin 42, Nr. 8 (2019): 758–63.
- Scharnhorst, Julia. „Resilienz / 1.1 Herkunft des Begriffs“. Haufe.de. Zugegriffen 24. Juli 2023. https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/resilienz-11-herkunft-des-begriffs_idesk_PI42323_HI7563955.html.
- Schmitz-Eggen, von Lars. „8 Tipps, damit Retter gesund bleiben“. rettungsdienst.de, 5. April 2019. https://www.rettungsdienst.de/tipps-wissen/8-tipps-damit-retter-gesund-bleiben-47849.
- Schneider, Melanie, Saskia Deist, und Petra Lührmann. „Ernährungssituation im Rettungsdienst“. Notfall + Rettungsmedizin, 28. Oktober 2022. https://doi.org/10.1007/s10049-022-01085-x.
- Schröer, Laura. „Betriebliches Gesundheitsmanagement im Rettungsdienst“. 19. November 2020. https://www.drk-hessen.de/fileadmin/Eigene_Dokumente/Rettungsdienst_und_Notfallmanagement/RDS_2019/2._Block/2019-RDS-2-5_Laura_Schroer_Gesundheitsmanagement_auch_im_Rettungsdienst_-_und_wie..pdf.
- Schumann, Alice, und Irina Böckelmann. „Wenn der Job krank macht: Burn-out im Fokus der Arbeitsmedizin“. Rettungsdienst – Zeitschrift für präklinische Notfallmedizin 42, Nr. 11 (2019): 1058–61.
- Schumann, Heiko, Julia Botscharow, Beatrice Thielmann, und Irina Böckelmann. „Erholungs-Beanspruchungs-Zustand im Rettungsdienst während der ersten beiden Wellen der SARS-CoV-2-Pandemie“. Notfall + Rettungsmedizin, 29. November 2022. https://doi.org/10.1007/s10049-022-01102-z.
- Schumann, Heiko, Thomas Hering, und Kathrin Stoltze. „Resilienz im Rettungsdienst: Ein Schutzschild gegen Belastung?“ Rettungsdienst – Zeitschrift für präklinische Notfallmedizin 43, Nr. 4 (2020): 352–56.
- Schumann, Heiko, und Gordon Heringshausen. „Alkohol, Zigaretten & Co.: Konsum bedeutet Gefahr – auch für Einsatzkräfte!“ Rettungsdienst – Zeitschrift für präklinische Notfallmedizin 43, Nr. 4 (2020): 346–50.
- Schumann, Heiko, Kathrin Stoltze, Gordon Heringshausen, und Irina Böckelmann. „Arbeitsbedingte Belastungen: Gibt es Unterschiede zwischen Feuerwehren und Hilfsorganisationen?“ Rettungsdienst – Zeitschrift für präklinische Notfallmedizin 43, Nr. 4 (2020): 332–39.
- Schwab, Markus. „Psychohygiene – Unterstützungsangebote für Betroffene und Einsatzkräfte“. retten! 8, Nr. 04 (September 2019): 238–42. https://doi.org/10.1055/a-0903-0323.
- Thielmann, Beatrice, und Irina Böckelmann. „Ernährungstipps für Beschäftigte im Rettungsdienst: Wissenschaftliche Grundlagen“. Rettungsdienst – Zeitschrift für präklinische Notfallmedizin 42, Nr. 11 (2019): 1050–56.
- Tracogna, U., J. Klewer, und J. Kugler. „Gesundheitsverhalten und Gesundheitszustand von Pflegepersonal im Krankenhaus“. Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement 8, Nr. 2 (April 2003): 115–19. https://doi.org/10.1055/s-2003-39143.
- Voigt, Karen, Sabine Twork, Dirk Mittag, Anne Göbel, Roger Voigt, Jörg Klewer, Joachim Kugler, Stefan R Bornstein, und Antje Bergmann. „Consumption of Alcohol, Cigarettes and Illegal Substances among Physicians and Medical Students in Brandenburg and Saxony (Germany)“. BMC Health Services Research 9, Nr. 1 (Dezember 2009): 219. https://doi.org/10.1186/1472-6963-9-219.
- World Health Organization. „Self-Care Month“. World Health Organization. Zugegriffen 13. Juli 2023. https://www.who.int/news-room/events/detail/2023/06/24/default-calendar/self-care-month.
- Zehner, Janine, und Heike Friedewald. „Jeder 7. Beschäftigte im Rettungsdienst berichtet von Depression: Neues Online-Angebot zur psychischen Gesundheit von Rettungskräften gestartet“. Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention, 21. September 2022. https://www.deutsche-depressionshilfe.de/presse-und-pr/pressemitteilungen?page_n358=2&file=files/cms/downloads/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202022/pressemitteilung_rupert_final.pdf.
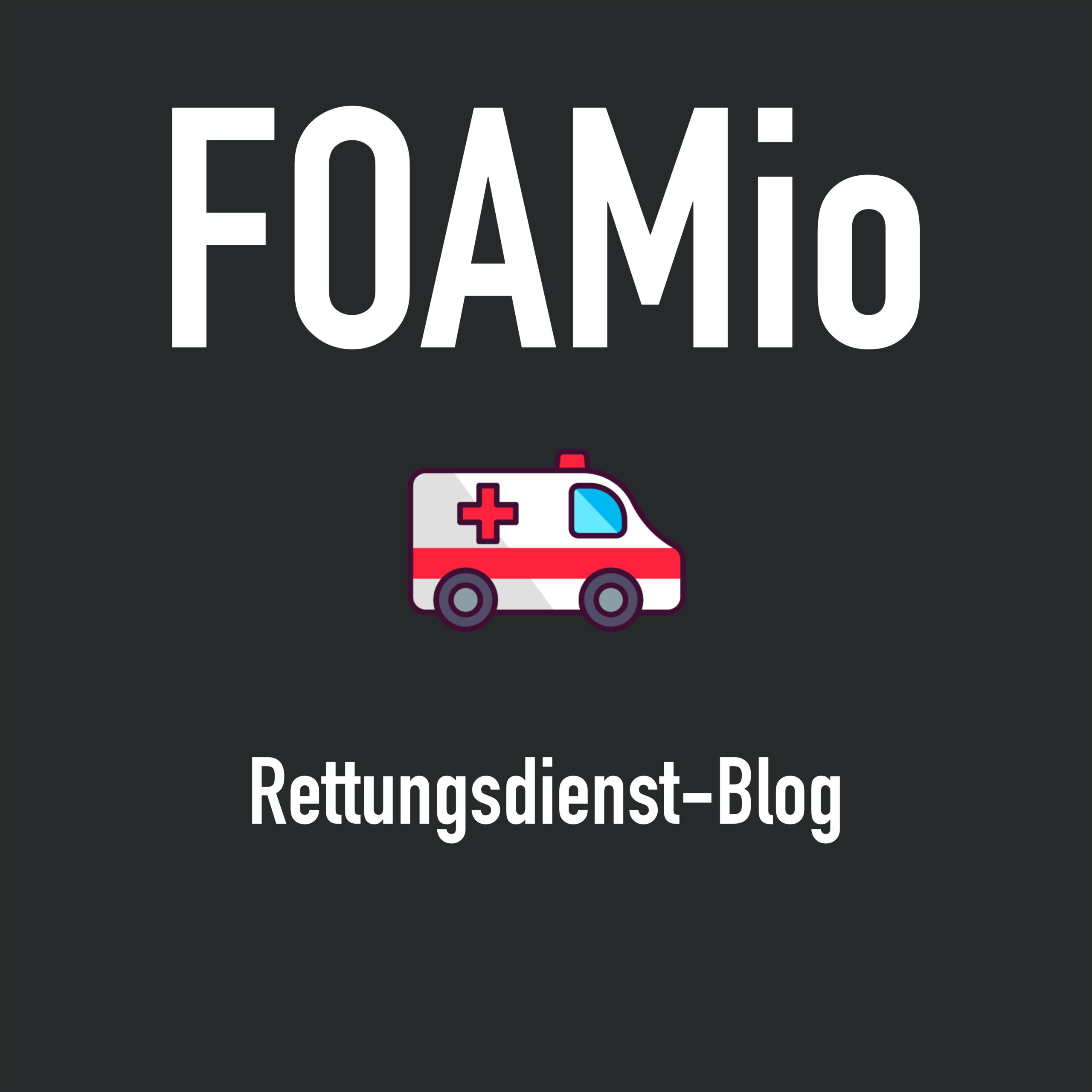
Sei der Erste der einen Kommentar abgibt