(Psychische) Erkrankungen machen auch vor den Feiertagen keinen Halt! Und da wir dieser Tage mit Christi Geburt die bekannteste Geburt weltweit feiern, gibt es kaum einen besseren Moment als sich heute und morgen mit auch mit einem schweren Thema, nämlich den Syndromen in Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder dem Wochenbett, wie sie im ICD-11 heißen, zu beschäftigen bzw. auf diese gar nicht so seltene Gruppe an Krankheitsbildern aufmerksam zu machen. Aus diesem Grund geht es bei „Im Notfall Psychiatrie“ heute um die postpartale Depression und morgen um die postpartale Psychose. Zu allererst sollte aber erst einmal der wichtige Begriff des „Wochenbetts“ zu klären. Bei der „Wochenbett“-Phase handelt es sich um die ersten 6 – 8 Wochen nach Geburt, in denen der mütterliche Körper von der Geburt regeneriert (mehr zum „Wochenbett“ gibt es im morgigen Beitrag). Diese Phase ist ebenfalls namensgebend für die beiden zuvor genannten Krankheitsbilder – Wochenbett-Depression und die Wochenbett-Psychose -, jedoch gilt es zu betonen, dass die Diagnosestellung hier bzgl. des Zeitraums nicht so starr gesehen wird, wie dieser mit 6 Wochen in der ICD-11 genannt wird, sondern Zeiträume von 6 bis sogar 12 Monaten einbeziehen. Auch schon vor der Entbindung zählen depressive Erkrankungen zu den häufigen Krankheitsbilder, v.a. bedingt durch Selbstzweifel hinsichtlich der zu erfüllenden Erwartungen und Anforderungen der Mutterschaft.
Grundsätzliches
Initial gilt es zu betonen, dass die postpartale Depression (PPD), welche auch als „Wochenbett-Depression“ oder „postnatale Depression“ bekannt ist, nicht mit dem sog. „Postpartum“- oder „Baby“-Blues zu verwechseln ist. Beim Baby-Blues handelt es sich gemäß ICD-11 um „leichte und vorübergehende depressive Symptome […], die nicht die diagnostischen Voraussetzungen für eine depressive Episode erfüllen […] und kurz nach der Entbindung auftreten“, die bei ca. 50 – 80 % aller Mütter auftreten. Der Postpartum-Blues, also die kurze Phase von i.d.R. einigen Stunden bis wenigen Tagen mit leichten Symptome einer Depression beginnen oft zwischen dem 3. und 5. Tag nach Geburt (Zeitraum der größten hormonellen Veränderungen nach Geburt) und klingen ohne therapeutische Intervention von selbst wieder ab und ist vor allem gekennzeichnet durch Stimmungslabilität, Ängstlichkeit, grundloses Weinen oder leichtes/plötzliches Verlieren der Fassung. Zu beobachten ist die Phase des Baby-Blues aber trotzdem, da der Übergang hin zu den pathologischen Wochenbett-Syndromen fließend ist und bei später Diagnose der Verlauf ggf. schwerer und auch länger ist sowie auch erhebliche Auswirkungen auf das Neugeborene haben kann.
Epidemiologie
In etwa 10 – 20 % aller Mütter erkranken nach Entbindung an einer postpartalen Depression, also jede 7. bis 10. Gebärende, wobei die Dunkelziffer wie bei den meisten psychiatrischen Erkrankung deutlicher höher sein wird. Auch die Hospitalierungsraten für psychische Erkrankungen sind 30 Tage post partum etwa 35-fach erhöht und 90 Tage post partum ca. 12,7-fach höher. Weitere epidemiologisch relevante Zahlen und Fakten sind z.B.:
- ca. 13 % der Patient*innen mit einer postpartalen psych. Erkrankung haben Angstzustände
- etwa 15 – 20 % der Patient*innen sind auch in ersten Jahr nach Geburt von Depressionen und Ängsten betroffen
- ca. 18 % aller Patient*innen zeigen schon während der Schwangerschaft depressive Symptome
- 0,27 von 100.000 Schwangeren bzw. jungen Müttern versterben innerhalb der ersten 6 Monate nach Geburt durch einen Suizid im Rahmen einer Depression (Großbritannien)
- etwa 72-fach erhöhtes Suizidrisiko bei postpartal stationär psychiatrisch behandelten Frauen im ersten Lebensjahr des Kindes
- auffälliger Peak bei den sog. „harten“ Suizidmethoden wie Erhängen oder Sturz aus großer Höhe bei Suiziden im Kontext postpartaler Erkrankungen
- nur 20 – 40 % der Patient*innen suchten professionelle Hilfe auf (Großbritannien)
- nur 18 % der psychisch kranken Schwangeren erhalten eine psychiatrische Diagnose
- bei 20 % der Schwangeren in ambulanter gynäkologischer Betreuung waren depressive Symptome detektierbar, aber nur 13,8 % davon waren in psychiatrischer Behandlung
- Risiko für PPD ist 6 % höher bei psychischer Gewalt durch Partner*in
- bis zu 50 % der Betroffenen erkranken bei weiterer Geburt erneut
- ca. 30 % der Patientinnen haben eine therapieresistente peripartale Depression (kein Ansprechen auf standardmäßige Erstlinientherapie)
Exkurs – postpartale Depression bei Männern
Was wahrscheinlich die meisten nicht wissen ist, dass Depressionen in Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder dem Wochenbett auch bei ca. 5 % der Männern auftreten und die Dunkelziffer wahrscheinlich erheblich höher liegt. Betrachtet man den Zeitraum von einem Jahr nach Geburt, so steigt die Zahl nochmals um mehr als das Doppelte auf etwa 10 %, in manchen Untersuchungen sogar bis zu 25 %. Eine große, weltweite Untersuchung zeigte, dass in 3 von 100 Familien sowohl Mutter als auch Vater gleichzeitig an einer postnatalen Depression litten. Symptomatisch zeigen sich bei Männern eher Versagensängste, Insuffizienzgefühle, vermeidenden Verhaltensweisen, Reizbarkeit, Aggressivität oder Gleichgültigkeit ggü. Kind und/oder Partnerin und es kommt öfters zum Alkohol- und/oder Substanzmissbrauch. I.d.R. treten bei Vätern die ersten Symptome zwischen dem 3. – 6. Lebensmonat des Kindes auf
Auch hier konnten bestimmte Hormonschwankungen festgestellt werden, die wahrscheinlich eine Rolle bei der Entstehung paternaler, postpartaler Depressionen spielen. V.a. der Testosteronabfall (Abfall um bis zu 30 %), Cortisol, Vasopressin & Prolaktin scheint hier relevant zu sein, denn je ausgeprägter der Abfall, desto stärker die Symptomausprägung. Zusätzlich zeigten Studien, dass väterliche Depressionen auch eine nachteilige Wirkung auf die emotionale Entwicklung der Kinder.
Ätiologie
Die genauen ätiologischen Mechanismen sind bis jetzt zu großen Teilen noch unklar. Aber ähnlich wie bei der Wochenbett-Psychose sind auch hier vermutlich die raschen, hormonellen Verschiebungen (z.B. Oxytocin-, Östrogen- & Progesteron-Abfall sowie vermutlich Dysfunktion des Enzyms Monoaminoxidase A) ursächlich, aber auch weitere externe, soziale und/oder psychische Faktoren haben als Risikofaktoren einen Anteil bei der Ausbildung einer puerperalen Psychose (s. nachfolgend). V.a. auch der Schlafentzug im Nachgang der Geburt kann zu biochemische Veränderungen führen und so das Entstehen einer PPD begünstigen, aber auch die genetische Veranlagung spielt ein größere Rolle.
Risiko- & Einflussfaktoren
- medizinisch-psychiatrische Vorgeschichte
- frühere depressive Episoden
- prämenstruelle dysphorische Störung (PMDS)
- Angststörung
- Substanzmissbrauch
- allgemein psychiatrische Störungen
- Familienanamnese bzgl. Depressionen/Psychosen
- chronische körperliche Erkrankung (z.B. Diabetes mit 1,85-fach höherem Risiko, Schilddrüsendysfunktion)
- soziale Risikofaktoren
- kaum soziale Unterstützung
- Beziehungs-/Paarkonflikte
- häusliche Gewalt
- Migration
- belastende Lebensereignisse (z.B. Verlusterfahrungen, Arbeitsplatzverlust)
- Missbrauchserfahrungen
- Probleme in der früheren Kindheit
- gestörte Sozialbeziehungen
- schlechte/unsichere Wohnverhältnisse (z.B. Wohnungsverlust, beengter Wohnraum)
- unzureichende finanzielle Absicherung
- Risikofaktoren bzgl. Persönlichkeit
- Probleme bei der Emotions-/Impulskontrolle
- hoher Selbstanspruch
- unsichere Bindungsmuster
- negative Einstellung zur Schwangerschaft
- Abschied von der Schwangerschaft und/oder vom „Traum-Baby“ sowie der eigenen Kindheit
- soziodemografische Risikofaktoren
- höheres Lebensalter der Mutter (wenn Depression in der Vorgeschichte)
- junges Lebensalter (wenn keine Depression in der Vorgeschichte)
- alleinlebende/-erziehende Mütter
- schwangerschaftsbezogene Risikofaktoren
- ungeplante/ungewollte Schwangerschaft
- langes Warten auf Schwangerschaft (ggf. verbunden mit vorhergehender Fehlgeburt)
- verklärtes, gesellschaftliches Mutterbild mit hohem Anspruch an werdende Mutter
- Gestationsdiabetes
- Präemklampsie
- pränatale Klinikaufenthalte
- geburtsbezogene Risikofaktoren
- Notkaiserschnitt oder vaginal-operative Entbindung
- vorzeitige Geburt
- geburtshilfebezogene Stressoren (z.B. traumatische Geburt)
- etwaige andere perinatale Komplikationen
- kindsbezogene Risikofaktoren
- anspruchsvoll-temperamentvolles Kind (z.B. „Schreikind“)
- fehlendes Bonding zw. Mutter & Kind
- gesundheitliche Beeinträchtigungen
Wie schon erwähnt können postpartale Depressionen auch bei Männern auftreten. Bei der Abklärung einer solchen Pathologie sollten die nachfolgenden Risikofaktoren berücksichtig werden:
- mütterliche postpartale Depression und/oder Schwangerschaftskomplikationen
- frühere depressive Episoden
- finanzielle Probleme (z.B. geringes Einkommen)
- belastende/stressige Lebensereignisse
- unzureichende soziale Unterstützung
- schlechte Partnerschaftsqualität
- Migrationshintergrund
- mehrere Kinder
- Frühgeburt
Symptomatik
In 70 % der Fälle setzen die Symptome der postpartalen Depression ca. 1 – 2 Wochen nach Geburt in Form eines schleichenden Verlaufes ein und dauern i.d.R. 3 – 9 Monate an. Die für die Diagnosestellung notwendige Symptomatik ist quasi identisch mit der Symptomatik der unipolaren Depression (siehe Beitrag „Was ist eigentlich… eine (unipolare) Depression?“ und die Kernsymptome sind eine gedrückte Stimmung, Antriebsverlust und Freud- & Interessenlosigkeit. Weitere relevante Symptome sind:
- Erschöpfung, Hoffnungslosigkeit und/oder Leeregefühl
- Appetitlosigkeit
- Konzentrations- und/oder Schlafstörungen
- allgemeines Desinteresse, sexuelle Unlust sowie sozialer Rückzug
- Stimmungsschwankungen (z.B. extreme Reizbarkeit & Aggression, häufiges Weinen sowie Unruhe oder Verlangsamung)
- Angstzustände, v.a. Angst vor Kontrollverlust oder das Kind nicht gut versorgen zu können (ggf. auch Panikattacken)
- Insuffizienzgefühle als Mutter/fehlende Muttergefühle
- Selbstvorwürfe/Schuldgefühle, mangelndes Selbstvertrauen
- Kälte- & Hitzegefühl, Kopfschmerzen, Schwindel, Herzrasen & andere psychosomatische Beschwerden
- Bindungsverzögerung/Beziehungsstörung (z.B. Empathiemangel)
- Probleme beim Stillen
- ambivalente Gefühle ggü. dem Neugeborenen (mangelndes Verständnis für Bedürfnisse des Säuglings)
- ggf. Alkohol- oder Drogenmissbrauch
- Zwangsgedanken (z.B. Schädigung des Kindes)
- ggf. selbstverletzendes Verhalten
- Suizid- und/oder Infantizidgedanken (in 89 % besteht Suizidalität; Suizidversuchsrate: 39 %; in 60,7 % infantizidale Gedanken)
Die Auswirkungen der maternalen, aber paternalen postpartalen Depression zeigen sich auch beim Neugeborenen und dies ggf. auch im späteren Leben, z.B. in Form von
- Schrei- und Schlafstörungen
- Wachstumsverzögerung
- Fütterungsstörungen/Stillprobleme
- Fehlernährung und/oder reduzierte Gewichtszunahme
- kognitiver, motorischer und emotionaler Entwicklungsrückstand
- erhöhte Vulnerabilität für psychische Erkrankungen (z.B. AHDS, affektive Erkrankungen)
- gelernte Hilflosigkeit, emotionale Irritation, weniger positive Affekte und Mimik
Anamnese & Diagnostik
Die Abklärung der Fremd- & Eigengefährdung hat selbsterklärend oberste Priorität. Zusätzlich sollten anamnestisch folgende Punkte abgeklärt werden:
- Dauer, Art und Ausmaß der Symptomatik (v.a. auf das Kind bezogene Symptome)
- Selbst- & Fremdaggression/-gefährdung
- aktuelles Funktionsniveau bzw. Leidensdruck
- vorbestehende psychische Erkrankungen, v.a. Depression und Bipolarität
- Umstände bzgl. Schwangerschaft und Geburt
- Besonderheiten bzgl. des Neugeborenen (z.B. „Schreikind“)
- allgemeine Lebensumstände & Ressourcen (soziobiografische Anamnese)
- Medikamenten- & Suchtmittelanamnese
- weitere Abklärung der o.g. Risikofaktoren
- Fremdanamnese bzgl. Symptomausprägung, Auswirkung auf Familie etc.
Zur Diagnosestellung eignet sich die Edinburgh-Postnatal-Depressions-Skala (EPDS), wobei zu beachten ist, dass in einigen Untersuchungen die EPDS nicht mehr als 20 % der betroffenen Patientinnen detektiert. Zur Gesamtdiagnostik, v.a. um andere Erkrankungen auszuschließen gehören:
- vollständige körperliche Untersuchung
- Labor-Diagnostik (Blutbild, Entzündungsparameter, Schilddrüsen-, Nieren- & Leberwerte, Elektrolyte, Harnsäure, BZ, Vitamin B12, Folsäure, Kortisol, TPHA, Borrelien sowie Drogenscreening)
- ggf. cerebrale Bildgebung (cCT, besser MRT)
- Liquorpunktion bei V.a. Infektion oder Demenz
- EEG bei V.a. Epilepsie
Differentialdiagnostisch ist vor allem die Unterscheidung zum o.g. „Baby-Blues“, also dem kurzen, ohne therapeutische Intervention selbst limitiertierenden Stimmungstief nach der Geburt. Trotz ziemlich ähnlicher Symptome kommt es nach wenigen tagen zum Sistieren der Symptome, was auch das klarste Unterscheidungskriterium zur PPD darstellt. Eine weitere relevante Differentialdiagnose ist die Wochenbett-Psychose, die i.d.R. einer sofortigen stationären Behandlung bedarf. Weitere Differentialdiagnosen sind z.B.:
- organischen Ursachen (z.B. Entzündungen/Infektionen, maligne Erkrankungen etc.)
- Hypo-/Hyperthyreose
- Hypo-/Hyperparathyreoidismus
- Eisenmangelanämie
- (vorbestehende) schizophrene Krankheitsbilder
- (vorbestehende) Persönlichkeitsstörungen
- (vorbestehende) Zwangs- & Angststörungen
- (vorbestehende) posttraumatische Belastungsstörung
- bestehender Drogenkonsum/-entzug
Exkurs: Diagnostik durch Social Media
Horvitz et al. veröffentlichten im Jahr 2014 eine sehr interessante Arbeit über Methoden der Diagnostik bzw. Prädiktion postpartaler Depressionen. Hierzu durften werdende Mütter initial in einer Online-Untersuchungen den PHQ-9-Fragebogen beantworten und wurden auch hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit postpartalen Depressionen gescreent. Anschließend beobachtete bzw. untersuchte die Forschungsgruppe die Aktivitäten, Interaktionen, emotionalen & sprachlichen Äußerungen der Mütter auf Facebook und konnten so über ein statistisches Modell mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 % das PPD-Entstehen vorhersagen.
Therapie
Genauso wie bei der Diagnostik erfolgt auch die Therapie der Wochenbett-Depression wie bei anderen affektiven Erkrankungen. Insgesamt ist die postpartale Depression aber gut behandelbar. Bei betroffenen Personen sollte trotzdem eine engmaschige psychotherapeutische Begleitung erfolgen und ggf. auch weitere Unterstützung durch Sozialarbeiter*innen o.Ä. erwogen werden. Unbehandelt kann eine PPD schwere und langfristige Folgen für Mutter, Kind sowie den Vater haben. Insgesamt ist auf eine reizarme Umgebung und der Sicherung von ausreichend Schlaf von großer Wichtigkeit.
Psychotherapeutisch ist das Ziel vor allem über die Erkrankung aufzuklären, um dadurch ein besseres Verständnis für sich selbst zu entwickeln, sich besser auf die neue Situation einzustellen und somit eine bessere/verbesserte Mutter-Kind-Beziehung zu realisieren. Hierbei sollte v.a. die Partner*innen sowie andere Familienangehörige nicht vergessen werden. Oftmals erfolgt die Therapie nach dem verhaltenstherapeutischen und/oder einem interpersonellen Ansatz. Ein weiterer und anzuratender Ansatz sind Mütter- bzw. Selbsthilfegruppen, da hier ein direkter Austausch zwischen Betroffenen möglich ist und man sich gegenseitig helfen kann und so Selbstwirksamkeit erfährt.
Abhängig von der Ausprägung der depressiven Symptomatik ist eine medikamentöse Therapie zu erwägen bzw. unumgänglich, v.a. da diese der schnellste Ansatz zur Linderung der Symptome ist. I.d.R. ist die medikamentöse Behandlung auch mit dem Stillen vereinbar. Hinsichtich der Auswirkungen der Psychopharmaka auf die Mutter und v.a. auf das Kind gibt unzureichende Daten, aber für die älteren trizyklischen Antidepressiva und häufig eingesetzte Arzneimittel wie Fluoxetin, Paroxetin, Sertralin und Citalopram aus der Gruppe der SSRI liegen ausreichend Studien vor, um die Fragen bzgl. der Auswirkungen zu beantworten. Alle genannten Substanzen sind plazentagängig und/oder in der Muttermilch nachweisbar und grundsätzlich gelten Grundregeln wie die hohe Empfindlichkeit des Embryos im 1. Trimenon. Bei der Auswahl der Psychopharmaka sei hier auf die nachfolgende Tabelle aus dem Ärzteblatt oder das Portal „Embryotox“ verwiesen.

Eine mögliche Auswirkungen der Psychopharmaka ist laut einiger Untersuchungen das höhere Risiko für eine Anpassungsstörungen bei bis zu 30 % der exponierten Kinder, welche sich v.a. in Form von Atemschwierigkeiten, Hypoglykämie, Hyper-/Hypotonie, Tremor, Trinkschwäche, Somnolenz, Schreckhaftigkeit sowie Muskeltonusveränderungen bzw. extrapyramidal-motorische Störungen (EPMS)
Sollte die Symptomausprägung zu groß sein, also in Fällen schwerster Depressionen mit/ohne puerperale Psychosen, so ist ein Klinikaufenthalt ggf. zwingend notwendig. Dieser muss ggf. auch gegen den Willen der Patientinnen und mit einer initialen Trennung von Mutter & Kind erfolgen. Sofern bzw. sobald möglich ist die Unterbringung von Mutter und Kind auf einer Mutter-Kind-Station zu ermöglichen, jedoch steht im Zusammenhang mit einer Fremdgefährdung für das Neugeborene das Wohl des selbigen im Vordergrund.
Zusätzlich sind alternative Verfahren wie repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS) und transkranielle Gleichstromstimulation (tDCS) aufgrund der scheinbar guten Wirkung zu erwägen. Genauso wie bei der unipolaren Depression ist die Elektrokrampftherapie (EKT) auch bei schweren, therapierefraktären, postpartalen Depressionen hochwirksam und ist auch bei vital bedrohlichen oder schweren therapieresistenten Depressionen indiziert.
Erst dieses Jahr wurde in den USA das Medikament „Zurzuvae„, ein den GABA-A-Rezeptor modulierendes Neurosteroid als erster Wirkstoff zur Behandlung einer postpartalen Depression zugelassen. Die Zulassung in der EU steht noch aus und es sind noch weitere und größe Untersuchungen notwendig, um vor allem ggf. bestehende Auswirkungen auf das Neugeborene sowie sonstige Nebenwirkungen genauer abzuklären.
Für weitere Informationen zu den peripartalen psychischen Erkrankungen empfiehlt sich auf jeden Fall auch der Besuch der Homepage des Vereins „Schatten und Licht e.V.„.
Zu diesem Beitrag gibt es natürlich auch wieder ein dazugehöriges PsychFacts.
Quellen
- Andreae, Susanne, Christine Grützner, und Martin Hoffmann, Hrsg. Lexikon der Krankheiten und Untersuchungen: mit] 85 Tabellen; [die 1000 wichtigsten Krankheiten und Untersuchungen. 2. überarb. und erw. Aufl. Stuttgart New York: Thieme, 2008.
- Antwerpes, Frank, Helmut Hentschel, Fiona Walter, Inga Haas, Isabella Sharif Samani, Timo Freyer, und Sabrina Mörkl. „Wochenbettdepression“. DocCheck Flexikon, 15. August 2023. https://flexikon.doccheck.com/de/Wochenbettdepression.
- Bandelow, Borwin, Oliver Gruber, und Peter Falkai. Kurzlehrbuch Psychiatrie. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. https://doi.org/10.1007/978-3-642-29895-0.
- Barth, Nina. „Erste Pille gegen Wochenbettdepression in den USA zugelassen“. tagesschau.de, 10. August 2023. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-wochenbett-depression-medikament-100.html.
- Bauer, Michael, Andreas Meyer-Lindenberg, Falk Kiefer, und Alexandra Philipsen, Hrsg. Referenz Psychische Störungen. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG, 2021. https://doi.org/10.1055/b000000068.
- Bergink, Veerle, Natalie Rasgon, und Katherine L. Wisner. „Postpartum Psychosis: Madness, Mania, and Melancholia in Motherhood“. American Journal of Psychiatry 173, Nr. 12 (Dezember 2016): 1179–88. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2016.16040454.
- Department for Health and Wellbeing, Government of South Australia. „Psychotic Disorders in the Perinatal Period (Schizophrenia, Bipolar Disorder and Postpartum Psychosis)“. Department for Health and Wellbeing, Government of South Australia, 28. September 2020. https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/8fbf20004eeda373b123b36a7ac0d6e4/Psychotic+Disorders+in+the+Perinatal+Period+%28Schizophrenia+Bipolar+Disorder+and+Postpartum+Psychosis%29_PPG_v6_0.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8fbf20004eeda373b123b36a7ac0d6e4-ocRym1w.
- Dominiak, Monika, Anna Z. Antosik-Wojcinska, Marta Baron, Pawel Mierzejewski, und Lukasz Swiecicki. „Recommendations for the prevention and treatment of postpartum depression“. Ginekologia Polska 92, Nr. 2 (26. Februar 2021): 153–64. https://doi.org/10.5603/GP.a2020.0141.
- Engemann, Ina. „Behandlung der Postpartalen Psychose | Gelbe Liste“. Zugegriffen 11. Dezember 2023. https://www.gelbe-liste.de/psychiatrie/postpartale-psychose-behandlung.
- Falkai, Peter, Gerd Laux, Arno Deister, Hans-Jürgen Möller, Krisztina Adorjan, Robert Perneczky, Gerd Schulte-Körne, und Hellmuth Braun-Scharm, Hrsg. Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie: 302 Abbildungen. 7., Vollständig überarbeitete Auflage. Duale Reihe. Stuttgart: Thieme, 2022. https://doi.org/10.1055/b000000071.
- Grossmann, Stefanie. „Wochenbett – Zwischen Babyglück und Babyblues“. NDR, 2. Oktober 2023. https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Wochenbett-Zwischen-Babyglueck-und-Babyblues,wochenbett104.html.
- Haas, Inga, Isabella Sharif Samani, und Astrid Högemann. „Puerperale Psychose“. DocCheck Flexikon, 21. September 2021. https://flexikon.doccheck.com/de/Puerperale_Psychose.
- Hahn, Martina, und Sibylle C. Roll. „Postpartale psychische Erkrankungen: Von Angst und Zwang bis zur Psychose“. Pharmazeutische Zeitung online, 23. August 2020. https://www.pharmazeutische-zeitung.de/von-angst-und-zwang-bis-zur-psychose-119642/?limit=all.
- Hübner-Liebermann, Bettina, Helmut Hausner, und Markus Wittmann. „Recognizing and Treating Peripartum Depression“. Deutsches Ärzteblatt international, 15. Juni 2012. https://doi.org/10.3238/arztebl.2012.0419.
- IKK classic. „Wochenbettdepression: Wenn das Babyglück ausbleibt“. Zugegriffen 15. Dezember 2023. https://www.ikk-classic.de/gesund-machen/familie/wochenbettdepression.
- International Classification of Diseases, Eleventh Revision (ICD-11), World Health Organization (WHO) 2019/2021 https://icd.who.int/browse11.
- Kanis, Annette. „Postpartale Depression bei Vätern – Psyche nach der Geburt“. ZDFheute, 5. März 2023. https://www.zdf.de/nachrichten/ratgeber/gesundheit/depression-geburt-postpartal-vater-100.html.
- Koch, Sabrina, Leonardo De Pascalis, Fabielle Vivian, Anelise Meurer Renner, Lynne Murray, und Adriane Arteche. „Effects of Male Postpartum Depression on Father–Infant Interaction: The Mediating Role of Face Processing“. Infant Mental Health Journal 40, Nr. 2 (März 2019): 263–76. https://doi.org/10.1002/imhj.21769.
- Köpf, Maria. „Postpartale Depression: Stimmungstief statt Mutterglück“. Spektrum.de, 3. Januar 2023. https://www.spektrum.de/news/postpartale-depression-stimmungstief-statt-mutterglueck/2091750.
- Lanczik, Mario Horst, und Ian Fraser Brockington. „Postpartal auftretende psychische Erkrankungen: Stationäre psychiatrische Behandlung von Mutter und Kleinkind“. Deutsches Ärzteblatt 94, Nr. 46 (14. November 1997). https://www.aerzteblatt.de/archiv/8500/Postpartal-auftretende-psychische-Erkrankungen-Stationaere-psychiatrische-Behandlung-von-Mutter-und-Kleinkind.
- Mehta, D., D. J. Newport, G. Frishman, L. Kraus, M. Rex-Haffner, J. C. Ritchie, A. Lori, u. a. „Early Predictive Biomarkers for Postpartum Depression Point to a Role for Estrogen Receptor Signaling“. Psychological Medicine 44, Nr. 11 (August 2014): 2309–22. https://doi.org/10.1017/S0033291713003231.
- National Childbirth Trust. „Postnatal Depression in Dads and Co-Parents: 10 Things You Should Know | Life as a Parent Articles & Support“. NCT (National Childbirth Trust), 14. November 2022. https://www.nct.org.uk/life-parent/emotions/postnatal-depression-dads-and-co-parents-10-things-you-should-know.
- Postpartale Depression Schweiz. „Postpartale Depression – Väter und Postpartale Depressionen“. Zugegriffen 21. Dezember 2023. https://postpartale-depression.ch/de/informationen/fokusthemen/item/vaeter-und-postnatale-depressionen.html.
- Postpartale Depression Schweiz. „Symptome der Postpartalen Depression“. Zugegriffen 15. Dezember 2023. https://postpartale-depression.ch/de/informationen/symptome/postpartale-depression.html.
- Postpartale Depression Schweiz. „Symptome der Postpartalen Psychose“. Zugegriffen 15. Dezember 2023. https://postpartale-depression.ch/de/informationen/symptome/postpartale-psychose.html.
- Redaktion Gesundheitsportal. „Wochenbettpsychose“. Gesundheit.gv.at, 6. Mai 2022. https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/nach-der-geburt/wochenbettpsychose.html.
- Redaktion Gesundheitsportal, und Martin Aigner. „Wochenbettdepression (Postpartale Depression)“. Gesundheit.gv.at, 6. Mai 2022. https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/nach-der-geburt/baby-blues.html.
- Ruggeri, Amanda. „Male Postnatal Depression: Why Men Struggle in Silence“. BBC, 6. Juni 2022. https://www.bbc.com/worklife/article/20220601-male-postnatal-depression-why-men-struggle-in-silence.
- Schatten & Licht e.V. „Krankheitsbilder“. Zugegriffen 15. Dezember 2023. https://schatten-und-licht.de/krankheitsbilder/.
- Schatten & Licht e.V. „Ursachen“. Zugegriffen 15. Dezember 2023. https://schatten-und-licht.de/ursachen/.
- Sharma, Verinder, und Priya Sharma. „Postpartum Depression: Diagnostic and Treatment Issues“. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada 34, Nr. 5 (Mai 2012): 436–42. https://doi.org/10.1016/S1701-2163(16)35240-9.
- Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. „In der Schwangerschaft und nach der Geburt – Stiftung Deutsche Depressionshilfe“. Zugegriffen 15. Dezember 2023. https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/depression-in-verschiedenen-facetten/in-der-schwangerschaft-und-nach-der-geburt.
- Trautmann-Villalba, Patricia. „Peripartale psychische Erkrankungen – Auch Männer sind betroffen“. Universimed, 19. Dezember 2019. https://www.universimed.com/ch/article/psychiatrie/auch-maenner-sind-betroffen-2126448.
- Völkel, Birgit. „Wochenbettpsychose“. Pschyrembel Online, 1. November 2022. https://www.pschyrembel.de/Wochenbettpsychose/K0P5G.
- Wolkenstein, Larissa. Postpartale Depression. 1. Auflage. Fortschritte der Psychotherapie, Band 89. Göttingen: hogrefe, 2023.
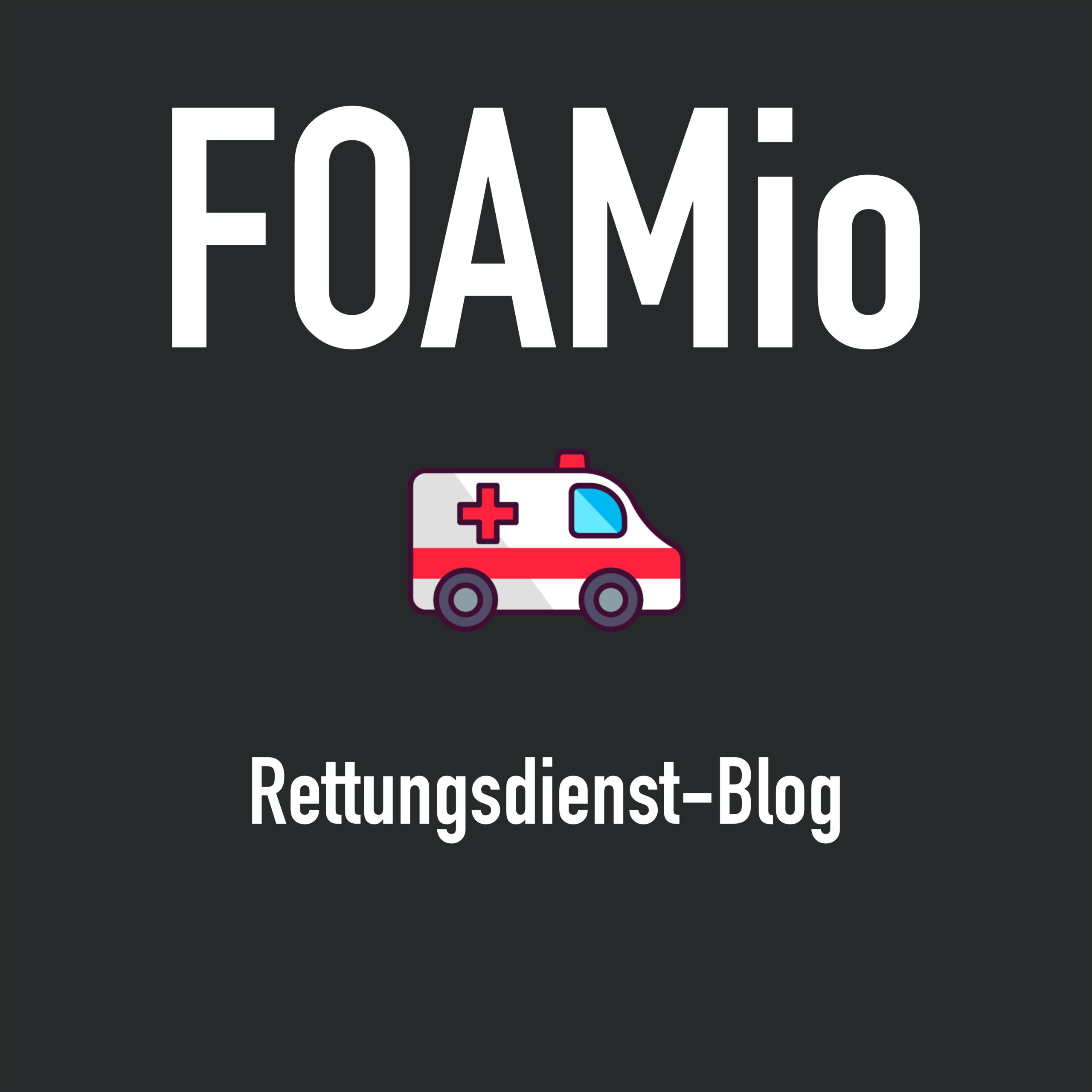

Sei der Erste der einen Kommentar abgibt