Nach einer längeren Pause gibt es heute Abend endlich den nächsten „Im Notfall Psychiatrie“-Beitrag und zwar zur bipolaren Störung, welche früher auch unter der Bezeichnung manisch-depressive Erkrankung bekannt war. Bei der bipolaren Störung handelt es sich um ein episodisches Krankheitsbild aus dem „Formenkreis“ der affektiven Störungen, welches aus depressiven Episoden/Perioden im Wechsel mit manischen, gemischten oder hypomanischen Episoden besteht und unbehandelt i.d.R. gravierende soziale Folgen und eine hohe Morbidität und Mortalität hat. Zu den sozialen Folgen zählen z.B. Arbeitsunfähigkeitszeiten, Verlust der Berufs- und Erwerbsfähigkeit, Partnerverlust, familiäre Zerwürfnisse und sozialer Isolation/Ausgrenzung. Laut dem Global Burden of Disease kommt es durch eine bipolare Erkrankung zu einem einen höheren Verlust an gesunden Lebensjahren als z.B. bei allen Krebsformen oder neurologischen Erkrankungen wie Epilepsie oder Alzheimer. Der Hauptgrund hierfür sind vor allem der frühe Beginn der bipolaren Störung verbunden mit einer sehr wahrscheinlichen Chronifizierung über die gesamte Lebensspanne. In Zahlen ausgedrückt versterben Frauen mit einer bipolaren Erkrankung 9 Jahre früher und Männer 8,5 Jahre. Nach Aussagen der WHO zählt die bipolare Störung zu den zehn Erkrankungen, welche mit der höchsten Rate dauerhafter Behinderung assoziiert sind.
Notfallmedizinisch betrachtet fehlen genaue Zahlen zur Rate an Patient*innen mit einer bipolaren Störung, insbesondere von Betroffenen in einer manischen Episode. Einzelne Auswertungen gehen von einem geringen Anteil um die 0,15 % aus, obwohl die Inzidenz von Erregungszuständen bei einer bipolar-affektiven Störung zwischen 52 - 88 % liegen. In einer französischen Untersuchung waren unter 500 Patient*innen nur zwei Betroffene mit einer Manie.
Grundsätzliches
Die bipolare Störung lässt sich in zwei Typen unterteilen. Die bipolare Störung Typ I ist durch das Auftreten von mindestens einer vollständig ausgebildeten manischen oder gemischten Episode gekennzeichnet und die bipolare Störung Typ II zeichnet sich durch das Auftreten einer bzw. mehrerer hypomanischer Episoden und mindestens einer depressiven Episode aus. Insgesamt ist aber zu betonen, dass man wie bei vielen anderen psychiatrischen Erkrankungen auch von einem Spektrum hinsichtlich der Ausprägung auszugehen ist.
Was die genaue Ursache für eine bipolare Störung ist, ist zu großen Teilen noch unklar. Es wird aber angenommen, dass die bipolare Erkrankung einer multifaktoriellen Genese unterliegt, wobei auch biopsychosozialer Einflussfaktoren wie belastenden Lebensereignisse und Persönlichkeitscharakteristika eine Rolle spielen. Durch Zwillingsstudien ist aber stark anzunehmen, dass die Genetik einen großen Anteil hat. Diese Studien zeigten zum Beispiel, dass bei Verwandten 1. Grades ein etwa 10-fach höheres Risiko für eine bipolare Störung haben. Bei eineiigen Zwillingen sind sogar Konkordanzraten von ca. 80 % festzustellen. Es ist von einer geschätzten Heritabilität von 60 – 80 % auszugehen, was eine der höchsten Raten der Vererbbarkeit im Bereich der psychischen Erkrankungen darstellt. Im Bereich der Genetik sind bis jetzt etwa 30 relevante Gen-Loci identifiziert, welche vor allem Ionenkanäle, Neurotransmitter-Transporter und synaptische Komponenten kodieren. Von besonderer Relevanz könnten hierbei Kalium-Kanäle sein.
Es gibt auch einige neurobiologische Annahmen bzw. Erklärungsmodelle, jedoch muss man konstatieren, dass sich aus diesen Annahmen noch kein überzeugendes ätiopathogenetisches Modell ableiten lässt. Jedoch gibt es Untersuchungen mittels funktioneller Bildgebung (funktionelle MRT und PET) die z.B. folgende Auffälligkeiten detektieren konnten:
- Volumenreduktion im Hippocampus, Thalamus und Amygdala sowie dorsolateralen frontalen Kortex
- vergrößerte Seitenventrikel (v.a. bei Bipolar-I-Störung ausgeprägt)
- dünnere kortikale graue Substanz in frontalen, temporalen und parietalen Regionen beider Hemisphären (assoziiert mit der Krankheitsdauer)
- verschlechterte intrazellulären Signaltransduktion bei verändertem Phosphatidyl-Inositol-Systems und intrazellullärer Natrium- und Kalziumionen-Dysregulation
- veränderte serotonerge, noradrenerge und dopaminerge Neurotransmission
- Überaktivitität neuroendokrinologischer Systeme wie HPA-Stress-System (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse) und Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsen-System
- veränderter regionaler Blutfluss und Glukosemetabolismus limbisch und präfrontal-kortikal
- erhöhte Kreatin-, Lactat- & Glutamat- GABA-Konzentrationen in der grauen Substanz (Konzentrationsreduktion durch atypische Neuroleptika)
- erhöhte basale Sekretion von Kortisol und vom adrenokortikotropen Hormon
Auch einige Substanzen wie Sympathomimetika (Kokain, Amphetamine etc.), Alkohol oder Antidepressiva (Trizyklika, noradrenerge Wiederaufnahmehemmer) können Exazerbationen auslösen.
Symptomatik
I.d.R. beginnt die bipolare Erkrankung mit einer akut-symptomatischen Phase, an die sich ein wechselnder Verlauf der Remissionen und Rezidive anschließt. Auch wenn die Remissionen oftmals vollständig verlaufen, hat eine Vielzahl der Patient*innen Restbeschwerden, die sich unterschiedlich stark ausprägen. Die Rezidive treten in Form eigenständiger Episoden auf, welche sich durch manische, depressive, hypomanische oder gemischt manisch-depressive Symptome auszeichnen. Diese vier Phänomene sowie die Zyklomythie charakterisieren die bipolare Störung und werden nachfolgend näher beschrieben. Die einzelnen Episoden dauern im Regelfall einige Wochen bis zu mehreren Monaten (3 – 6 Monate). Die Zyklen zwischen den Episoden sind unterschiedlich lang und können von seltenen Episoden, also nur wenigen im gesamten Laufe des Lebens, bis zum Phänomen des „Rapid Cycling“, also mehr als vier Episoden pro Jahr reichen. Anders als man wahrscheinlich erwartet kommt es nicht zum Wechsel von Manie zu Depressionen, sondern im Regelfall überwiegt das eine oder das andere.
Zudem ist es wichtig zu erwähnen, dass bei der manischen sowie depressiven Episode ggf. auch psychotische Symptome vorliegen können. Dazu zählen Wahnvorstellungen und/oder Halluzinationen, wobei diese nicht typisch schizophrenen Symptomen (z. B. bizarre Wahngedanken, kommentierende Stimmen) entsprechen dürfen. Typische Formen des Wahns sind vor allem Größen-, Liebes-, Beziehungs- oder Verfolgungswahn.
Symptome einer manischen Episode (Manie)
Bei der Manie handelt es sich um einen ausgeprägt affektiven Zustand, der mindestens eine Woche anhält bzw. anhalten muss, sofern er nicht behandelt wird. Die Manie zeichnet sich durch eine gesteigerte Euphorie, Reizbarkeit und Expansivität, also ein Spektrum aufsässiger, oppositioneller, impulsiver, aggressiver, dissozialer bis delinquenter Verhaltensweisen, aus. Darüber hinaus sind folgende weitere Symptome zu beobachten:
- durch erhöhte Aktivität oder subjektives Gefühl gesteigerte Energie (übersteigerter Antrieb, Rastlosigkeit)
- schnelles oder gedrängtes Sprechen (Rededrang/Logorrhoe)
- Ideenflucht bzw. kognitive Hyperaktivität
- Aufmerksamkeits- & Konzentrationsschwierigkeiten
- Aufdringlichkeit bis Distanzlosigkeit
- gesteigertes Selbstwertgefühl oder Grandiosität mit verminderter Kritikfähigkeit
- Gönnerhaftigkeit mit Verschwendungsverhalten (Ausgeben hoher Geldbeträge im“Kaufrausch“, Kreditaufnahme, Firmengründung etc.)
- verringerte Realitätswahrnehmung
- vermindertes Schlafbedürfnis
- erhöhte Libido
- Ablenkbarkeit
- impulsives oder rücksichtsloses Risikoverhalten (Straßenverkehr, Sexualität, Sport)
- schnelle Wechsel zwischen verschiedenen Stimmungszuständen (Stimmungslabilität)
Trotz dessen, dass die Diagnosestellung nur den Nachweis einer einzigen manischen Episode erfordert, kommt es i.d.R. im Verlauf zu Wechsel mit depressiven Episoden. Zusätzlich lassen sich bei der Manie einige speziellere Symptommuster unterscheiden. Darunter sind zum Beispiel Formen wie…
- … die gereizte Manie, bei der die Patient*innen aggressiv und zornig sind.
- … die geordnete Manie, bei der z.B. die typische Ideenflucht fehlt und das Denken völlig adäquat und geordnet erscheint.
- … die heitere Manie, welche gekennzeichnet ist durch grundlose Heiterkeit, Optimismus und Scherzhaftigkeit.
- … die überkochende Manie, welche sich in Form von Halluzinationen, Ideenflucht, Katatonie und Konzentrationsstörungen zeigt.
- die unproduktive Manie, eine Form ohne Ideenflucht, aber mit langsamem und einfallslosem Denken.
- … die verworrene Manie, welche durch stark beschleunigte Gedankengänge und höhere Grade der Ideenflucht bis zur Denkzerfahrenheit gekennzeichnet ist.
Symptome einer hypomanischen Episode (Hypomanie)
Die Symptome der Hypomanie treten abgeschwächter als bei der Manie auf bzw. sind zwar abweichend von der typischen Stimmung, dem Energielevel und dem Verhalten, aber nicht schwerwiegend genug, um für eine relevante Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit verantwortlich zu sein. Die Symptome müssen, wenn nicht behandelt, mindestens mehrere Tage andauern, und zeigen sich wie folgt:
- anhaltende Stimmungsaufhellung
- erhöhte Reizbarkeit
- subjektives Gefühl erhöhter Energie
- erhöhte Gesprächigkeit
- schnelle oder rasende Gedanken
- erhöhtes Selbstwertgefühl
- vermindertes Schlafbedürfnis
- Ablenkbarkeit
- impulsives oder rücksichtsloses Verhalten
- reduzierte Selbstkontrolle sowie Selbstkritik- & Selbststeuerungsfähigkeit
Betroffene selbst erkennen ihre hypomanen Episoden selbst i.d.R. nicht, sondern diese fallen Angehörigen, Freunden oder Kollegen auf.
Symptome einer depressiven Episode
Bei der depressiven Episode handelt es sich um eine Phase gedrückter Stimmung bzw. verminderten Interesses an Aktivitäten (verminderter Antrieb, Energieverlust), welche in einem Zeitraum von mindestens zwei Wochen jeden Tag auftreten muss. Begleitet wird diese Phase von Symptomen wie
- Veränderung des Appetits (Appetitverlust mit Gewichtsverlust oder gesteigerter Appetit mit Gewichtszunahme)
- Veränderung des Schlafs (erhöhte Müdigkeit, Früherwachen, Morgentief)
- psychomotorische Unruhe oder Hemmung/Verlangsamung
- Libidoverlust
- übermäßige oder unangemessene Schuldgefühle
- Gefühle der Hoffnungslosigkeit, Wertlosigkeit sowie Schuldgefühle bis Schuldwahn
- Konzentrationsschwierigkeiten
- verringerte Entscheidungsfähigkeit
- Suizidalität (wiederkehrende Gedanken an den Tod, Suizidvorstellungen, Suizidversuche oder Suizidplanungen)
Zur depressiven Episode folgt nächsten Monat ein eigener Beitrag in der Kategorie „Im Notfall Psychiatrie„.
Symptome einer gemischten Episode
Bei der gemischten Episode handelt es sich um ein besonderes Phänomen im Spektrum der bipolaren Störung, welches sich vor allem durch eine komplizierten und erschwerten Behandlungsverlauf in Verbindung mit einem schlechteren Ansprechen auf Therapien und mit einer erhöhten Suizidrate präsentiert. Prominentes Problem ist das gleichzeitige und schnell wechselnde Auftreten mehrerer ausgeprägter manischer und depressiver Symptome wie depressive, dysphorische, euphorische oder expansive Stimmung. Die Wechsel zwischen den beiden Extremen können von Tag zu Tag, aber auch innerhalb desselben Tages auftreten. Die Symptome müssen die meiste Zeit des Tages, fast jeden Tag, während eines Zeitraums von mindestens zwei Wochen vorhanden sein, sofern keine Behandlung erfolgt. Trotz dessen, dass die Diagnosestellung nur den Nachweis einer einzigen gemischten Episode erfordert, kommt es i.d.R. im Verlauf zu Wechsel mit depressiven Episoden.
Gemischte Episoden sind prädiktiv für eine erhöhte Komorbidität, eine höhere Zahl von Krankheitsepisoden und gesteigerten Behandlungsbedarf mit längeren Arbeitsunfähigkeitszeiten sowie einem erhöhten Suizidrisiko.
Symptome einer Zyklothymie
Wenn es zu einer mindestens zwei Jahre anhaltenden Stimmungsinstabilität kommt, welche eine Vielzahl an Phasen mit hypomanischen und depressiven Symptomen umfasst und die während eines größeren Teils der Zeit vorhanden sind als sonst. Die hypomanischen Episoden können, müssen aber nicht die vollen Definitionsanforderungen einer hypomanischen Episode erfüllen. Wichtig ist jedoch, dass es keine Vorgeschichte manischer oder gemischter Episoden gibt und die depressiven Symptome nie schwerwiegend oder lang anhaltend genug waren, um die Diagnosekriterien einer depressiven Episode zu erfüllen. Alles in allem müssen die Symptome aber zu einem erheblichen Leidensdruck oder zu erheblichen Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen führen.
Spezialfall „Rapid Cycling“
Kommt es im Zusammenhang mit einer bipolaren Störung vom Typ I oder Typ II zu einer hohen Zahl von affektiven Episoden (min. 4 in den letzten 12 Monaten), so spricht man vom Rapid Cycling. Die einzelnen Phasen sind entweder durch die Wechsel der Stimmungspolarität oder durch Phasen der Remission abgegrenzt. Die affektiven Episoden können auch kürzer sein als die Episoden, welche es normalerweise bei der bipolaren Störungen vom Typ I oder II gibt. (CAVE: bei sehr schnellen Wechseln von depressiven und manischen Symptomen, also von Tag zu Tag oder innerhalb desselben Tages, so ist eher von einer gemischten Episode auszugehen)
Epidemiologie
Aufgrund der verschiedenen Untersuchungsansätzen bzw. Diagnosekriterien schwanken die epidemiologischen Daten für die bipolare Störung. Zusätzlich ist vor allem auch zwischen den zwei zuvor genannten Typen zu trennen. Auch gilt es zu betonen, dass die wahre Prävalenz stark unterschätzt ist, da die bipolare Störung überproportional nicht erkannt wird und zum Beispiel der unipolaren Depression oder der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung zugeordnet werden. Einige Verlaufsuntersuchungen konnten zeigen, dass eine relevante Anzahl erst ex post als bipolar klassifiziert wurden und ggf. sogar über die Hälfte der an einer unipolar depressiven erkrankten Personen nach einer Evaluation durch erfahrenes Fachpersonal eigentlich dem bipolaren Spektrum zuzuordnen waren. Auch konnte gezeigt werden, dass bis zu 10 % der Patient*innen mit einer Major Depression vermutlich auch unter einer „unterschwelligen“ bipolaren Störung litten, also die Kriterien der Major Depression erfüllten und zusätzlich manische Symptome hatten, welche aber die Kriterien für (Hypo-)Manie nicht vollständig erfüllt haben.
Grundsätzlich lässt sich aber konstatieren, dass das mittlere Alter bei Beginn der Erkrankung liegt bei ca. 21 Jahren, wobei häufig etwa 5 – 10 Jahre vergehen bis es zu einem ersten Krankenhausaufenthalt kommt. 75 % aller Patient*innen erleiden ihre erste Episode vor dem 25. Lebensjahr. Die Lebenszeitprävalenz (alle Krankheitsfälle im betrachteten Teil der Bevölkerung während eines bestimmten Zeitraums) der bipolaren Störung im Gesamten liegt bei ca. 1 – 4 % (Lebenszeitprävalenz Bipolar-Spektrumserkrankung: ca. 5 – 6 %). Die WHO geht zum Beispiel von höheren Zahlen der Betroffenen aus (bis 5 %), wobei hier die Kriterien weiter gefasst sind und auch subsyndromale Erscheinungsformen mit einbezogen sind. Ca. 10 % aller Betroffenen haben vier oder mehr Episoden pro Jahr, wobei Frauen hier häufiger betroffen sind. Des Weiteren zeigen Studien, dass depressive Phasen 3-mal so häufig sind wie manische Phasen und ausschließlich manische Episoden nur bei 5 % der affektiven Störungen auftreten.
Die Inzidenz (Anzahl der Neuerkrankungen während eines bestimmten Zeitraums) der bipolaren Störung Typ I bei Männern und Frauen gleich. Insgesamt sind ca. 0,8 – 1 % der erwachsenen Bevölkerung von einer bipolaren Störung Typ 1 betroffen. Bei der bipolaren Störung ist von einer Lebenszeitprävalenz von etwa 1 – 3 % sowie einer 12- Monats-Prävalenz von ca. 0,6 % auszugehen. Bei der bipolaren Störung Typ II liegt die Inzidenz bei Frauen etwas höher. Insgesamt sind ca. 0,5 % der erwachsenen Bevölkerung von einer bipolaren Störung Typ 2 betroffen. Die Zyklothymie hat eine Lebenszeitprävalenz von bis zu 5 %, wobei zu betonen ist, dass die Lebenszeitprävalenz für die „zyklothyme Persönlichkeit“ nur bei 0,4 % liegt.
Die Häufigkeit der gemischten Episoden wird mit bis zu 40 % angegeben. Die Prävalenz der gemischten Episoden nimmt mit dem Krankheitsverlauf sogar zu. Die Prävalenz bei der ersten Episode liegt bei etwa 6,7 % und bei der zehnten Episode dann ca. bei 18,2 %. Betrachtet man nur das „Rapid Cycling“, so sind bis zu 20 % aller Patient*innen mit einer bipolaren Störung Typ I von besonders schwerwiegenden Ausprägungen betroffen. Vor allem Frauen (ca. 80 %) leiden unter dieser besonders schwerwiegenden Form des Rapid Cycling.
Das Suizidrisiko ist bei bipolaren Patient*innen erheblich erhöht. So kommt es etwa doppelt so oft zu Suizidversuchen und bis zu dreimal häufiger zur Vollendung des Suizides im Vergleich zu Patient*innen mit einer unipolaren Depression. Noch stärker zeigt sich dies im Vergleich mit der Allgemeinbevölkerung, hier ist das Risiko etwa fünf- bis sechsfach höher. Besteht zusätzlich eine komorbide Substanzstörung ist das Suizidrisiko noch höher. Bei der lebenslangen Inzidenz von Suiziden gibt es Schätzungen, dass diese mindestens 15-fach höher ist im Vergleich zur nicht an einer bipolaren Störung erkrankten Bevölkerung. Somit lässt sich konstatieren, dass das Suizidrisiko bei Frauen 10-fach und bei Männern 8-fach erhöht ist und damit auch die höchste Suizidmortalität aller psychischen Erkrankungen. Etwa 25 – 50 % aller bipolar erkrankten Patient*innen unternehmen im Verlauf ihres Lebens Suizidversuche.
Neben der erhöhten Gefahr der Suizidalität haben fast 40 % der Betroffenen mindestens eine weitere psychische Erkrankung.
Anamnese & Diagnostik
Aufgrund der dynamischen Situation in manischen Episoden kann es in der Akutsituation sein, dass differenzierte diagnostische Maßnahmen nicht möglich sind. Hier steht vor allem die verbale Intervention (Deeskalation) im Vordergrund, um die Compliance der Patient*innen zu fördern. Da Betroffene oftmals durch die fehlende Compliance ihre Symptomatik selbst nicht bemerken bzw. erkennen, ist das Einholen einer Fremdanamnese von großer Relevanz und hilft in Kombination mit einer genauen Verhaltensbeobachtung bei der psychiatrischen Befunderhebung, um das Ausmaß der Erkrankungsschwere zu bewerten. Die (Fremd-)Anamnese sollte in jedem Fall die Erfassung verordneter Medikamente und/oder den Konsum psychotroper Substanzen umfassen.
In der Notfallsituation sollten spontane und unerwartete Ausbrüche bedacht werden (Erregung, Unruhe, Anspannung sowie eingeschränkter Realitätsbezug und eingeschränkte Steuerungsfähigkeit). Eigen- und Fremdschutz sowie die Abschätzung der Eigen- oder Fremdgefährdung stehen in solch einer Situation im Vordergrund. Trotz dessen ist zu beachten, dass eine Manie auch im Notfall nicht von vornherein die Absprachefähigkeit ausschließt. Wichtig ist es, dass initial nicht einholbare Informationen oder nicht durchgeführte Untersuchungen nach erfolgreicher Stabilisierung erfragt bzw. nachgeholt werden.
Die Durchführung einer genauen körperlichen und neurologischen Untersuchung zum Ausschluss möglicher organischer Ursachen ist unerlässlich (Monitoring von Atmung, HF, RR, Vigilanz, SpO2, BZ, GCS, EKG, Laborparameter etc.). Ist die neurologische Symptomatik auffällig, so ist ggf. auch eine intensivierte Diagnostik zu veranlassen (CT/MRT des Schädels, EEG, Liquorpunktion etc.). Gedanklich sollte berücksichtigt werden, dass eine unkritische Bewertung körperlicher Symptome manischer Patient*innen dazu führen kann, dass andere relevante Hinweise für körperliche Erkrankungen übersehen werden.
Diagnostisch ist grundsätzlich zu beachten, dass eine manische Episode obligat für eine bipolare Störung Typ I ist und gleichzeitig ein Ausschlusskriterium für die Diagnose einer bipolaren Störung Typ II ist. Im Umkehrschluss stellt eine oder auch mehrere Episoden mit hypomanen Symptomen ein definierendes Kriterium für eine bipolare Störung Typ II dar. Wie oben schon erwähnt, lassen sich hypomane Episoden durch die Dauer und vor allem durch die Ausprägung von manischen Episoden unterscheiden.
Relevante Risikofaktoren für das (Wieder-)Auftreten bipolarer Störungen sind zum Beispiel eine positive Familiengeschichte hinsichtlich affektiver Störungen (v.a. bipolare Störungen), depressive/hypomane Episoden in der Vorgeschichte, Vorliegen einer Angst- oder Schlafstörungen in der Kindheit sowie die Postpartalperiode bei Frauen.
Differentialdiagnostisch sollten die nachfolgenden Erkrankungen in jedem Fall bedacht bzw. ausgeschlossen werden:
- substanzinduzierte bipolare/bipolar-ähnliche Störung (Symptome bilden sich innerhalb kürzerer Zeit nach Substanzentzug zurück)
- ausbleibende Einnahme verordneter Medikamente
- medikamenteninduzierte Nebenwirkungen (z.B. Kortison, L-Dopa, ACE-Hemmer, Tuberkulostatika, Gabapentin, Antidepressiva sowie Psychostimulanzien wie Amphetamine, Kokain, Ecstasy)
- Schizophrenie und schizoaffektive Störung
- emotional instabile Persönlichkeitsstörung
- narzisstische Persönlichkeitsstörung
- (rezidivierende) unipolare Depression/Dysthymie
- Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
- organisch affektive Störungen, z.B. durch hirnorganische Erkrankungen wie Epilepsie, Enzephalitiden, MS, HIV, Demenzen, Neurosyphilis, Tumore sowie Schilddrüsen- und Nebennierenrindenerkrankungen oder Hypophysentumor (sekundäre Manie)
Hinsichtlich komorbider Erkrankungen lässt sich konstatieren, dass die bipolare Störung unter allen psychischen Erkrankungen die höchste Wahrscheinlichkeit für eine zweite psychische Erkrankung hat. Daten zeigten, dass mehr als 90 % der bipolaren Patient*innen eine Komorbidität haben. Zu den typischen komorbiden Erkrankungen zählen vor allem Sucht- und Angsterkrankungen. Die nachfolgenden Zahlen zeigen das Ausmaß der Komorbiditäten:
- schädlicher Alkoholgebrauch (39,1 %)
- Alkoholabhängigkeit (23,2 %)
- schädlicher Drogengebrauch (28,8 %)
- Drogenabhängigkeit (14 %)
- Cannabis-Konsumstörung (46 %)
- Störung durch Kokainmissbrauch (24 %)
- Störung durch Opioidmissbrauch (8,5 %)
Insgesamt besteht bei 60,3 % bei Bipolar-I- und 40,4 % bei Bipolar-II-Patient*innen ein Substanzmissbrauch und -abhängigkeit. Somit ist das Risiko eines komorbiden Substanzmissbrauchs oder -abhängigkeit im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung bis zu sechsfach erhöht. Weitere typische komorbide Erkrankungen sind
- Angsterkrankungen wie eine generalisierte Angststörung, spezifische Phobien, soziale Phobien, Agoraphobie in Verbindung mit einer Panikstörung (86,7 % bei Bipolar I und 89,2 % bei Bipolar II)
- posttraumatische Belastungsstörung
- Impulskontrollstörung (71,2 % bei Bipolar I und 70,4 % bei Bipolar II)
- Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (40,6 % bei Bipolar I und 42,3 % bei Bipolar II)
Therapie
Wie schon erwähnt kann es in Notfallsituationen der Fall sein, dass mit einer geminderten oder gar nicht vorhandenen Krankheitseinsicht zu rechnen ist, sodass ggf. notwendige therapeutische Maßnahmen regelhaft abgelehnt werden. Kommunikativ ist hier zu bedenken, dass ggf. eine zielgerichtete Kommunikation nicht möglich ist. Die Kommunikation sollte daher in einer sachlichen Art und Weise erfolgen und klare Grenzen mit einer gewissen „Großzügigkeit“ setzen. Ein unsicherer Kommunikationsstil, welcher von Angst oder aggressiver Gegenübertagungen geprägt ist, führt i.d.R. zu einer weiteren Eskalation der Situation. Im Mittelpunkt jeglicher Kommunikation sollten daher immer deeskalierende Maßnahmen stehen, hier ist es vor allem wichtig, dass alle Maßnahmen ggf. auch mehrmals erläutert werden. Im besten Falle sollte vor jeder Maßnahme die Zustimmung der Patient*innen eingeholt werden. Zur weiteren Deeskalation bzw. Entspannung der Situation sollte eine reizarme Umgebung geschaffen werden, da äußere Reize sonst oftmals zu einer Verschlechterung führen.
In der Präklinik sollten keine kausalen Therapien schizophrener Psychosen, Manien oder Psychosen anderer Genese eingeleitet werden. Diese sollten erst nach Hinzuziehung eines Facharztes oder in einer psychiatrischen Klinik geschehen. Wenn Maßnahmen gegen den Willen der Betroffenen (z.B. Fixierung oder medikamentöse Therapie bei Agitation) bei bestehender Eigen- oder Fremdgefährdung notwendig sind, so sollten diese so kurz und so wenig invasiv wie möglich sein. Kommt es zu beleidigenden Verbalitäten oder Drohungen, so sollten diese nicht bagatellisiert werden, sondern im Zweifelsfall als aggressiv einordnet werden.
medikamentöse Therapie
Die Therapie der 1. Wahl bei der Behandlung schwerer manischer oder gemischter Episoden besteht aus der Gabe von Lithium oder Valproat in Kombination mit einem Antipsychotikum. Ist die manische bzw. gemischte Episode weniger stark ausgeprägt, so kann auch eine Monotherapie mit Lithium, Valproat oder einem Antipsychotikum (atypische Antipsychotika bevorzugen) ausreichend sein. Alternativ zu Lithium oder Valproat kann auch die Gabe von Lamotrigin, Carbamazepin oder Oxcarbazepin erwogen werden. Kurz gesagt: Lithium ist das Mittel der Wahl bei der Phasenprophylaxe und Olanzapin, Quetiapin oder Risperidon bei der Akutbehandlung manischer Episoden.
- Lithium
- Wirksamkeit zeigt sich i.d.R. erst nach ca. 1 Woche
- nachfolgend regelmäßige Lithiumspiegelkontrolle notwendig
- sofern wirksam bei Akutbehandlung manischer Episoden, auch für Phasenprophylaxe unverändert nutzen
- Zielspiegel bei Akutbehandlung: 0,6 – 1,0 mmol/L
- Olanzapin
- schneller Wirkeintritt
- gutes Nebenwirkungs-/Sicherheitsprofil
- zusätzlich zugelassen für die Phasenprophylaxe manischer sowie depressiver Episoden
- Zieldosis bei Akutbehandlung: 10 – 20 mg/d
- Quetiapin
- sofern wirksam bei Akutbehandlung manischer Episoden, auch für Phasenprophylaxe unverändert nutzen
- Zieldosis bei Akutbehandlung: 600 mg/d
- Risperidon
- weniger sedierend als Olanzapin
- nicht für Phasenprophylaxe affektiver Episoden zugelassen
- Zieldosis bei Akutbehandlung: 2 – 6 mg/d
Bei ausgeprägter Agitation kann wie oben schon erwähnt ggf. eine kurze und zusätzliche Behandlung mit Benzodiazepinen notwendig sein. Zur medikamentöse Therapie der Agitation sieht die S2k-Leitlinie „Notfallpsychiatrie“ der DGPPN die primäre Gabe eines Benzodiazepin, ggf. auch in Kombikation mit einem Antipsychotikum, vor (s. Tabelle). Zusätzlich zeigte Loxapin als erstes inhalatives Antipsychotikum in Studien eine schnelle Wirksamkeit bei gleichzeitig guter Verträglichkeit und im Vergleich zu oral verabreichten Antipsychotika einen schnelleren Wirkeintritt. Für die medikamentöse Therapie der Agitation sind folgende Medikamente anwendbar:
| Wirkstoff | Substanzklasse | Dosierung | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| Haloperidol | Antipsychotikum | 5 – 10 mg i.m. (max. 30 mg, ggf. bis 100 mg) | CAVE: Herzrhythmusstörungen |
| Loxapin | Antipsychotikum | 9,1 mg inhalativ | – bei milder bis mittelgradiger Agitation – ggf. 2. Gabe nach 2 h |
| Diazepam | Benzodiazepin | 5 – 10 mg i.m./i.v. (max. 60 mg) | – CAVE: langsam wegen Atemdepression – ungeeignet bei Alkoholintox |
| Lorazepam | Benzodiazepin | 1 – 2,5 mg i.m./i.v. (max. 7,5 mg) | – CAVE: Atemdepression – bei älteren Patient*innen Dosisreduktion |
| Midazolam | Benzodiazepin | 2,5 – 10 mg i.m., i.v., i.n., bukkal | CAVE: keine Zulassung bei psychiatrischen Erkrankungen |
Antidepressiva sollten nach Möglichkeit im Anschluss an die Akutsituation reduziert oder abgesetzt werden, da diese ggf. als Nebenwirkung für die Exazerbation verantwortlich sein können (Studien zeigen, dass bei fast allen aktuell zugelassenen Antidepressiva eine Zunahme der Häufigkeit von Zyklen oder das Auftreten hypomanischer oder manischer Episoden beobachtet wurde). Zur Therapie schwerer manischer Episoden kann auch die Durchführung einer Elektrokonvulsionstherapie (EKT) erwogen werden.
Die Therapie gemischter Episoden erfolgt i.d.R. nach demselben Therapieregime wie die Therapie manischer Episoden.
Exkurs: Lithium als Medikament
Lithium-Ionen reichern sich intrazellulär an und sorgen so für eine Hemmung der Na+-K+-ATPase und sorgen somit für eine gehemmte, exozytotische Noradrenalin– und Dopaminfreisetzung. Die akut-antimanische Wirkung tritt wie erwähnt erst nach einigen Tagen (5 – 7 Tage) auf, nach dem Abklingen der manischen Episode wird es weiter aufgrund der rezidivprophylaktischen und stimmungsstabilisierenden Wirkung eingesetzt. Bis sich die Prophylaxe-Wirkung vollständig ausgebildet hat, vergehen i.d.R. mehr als 6 Monate. Lithium kann zusätzlich auch die Therapieresistenz ggü. Antidepressiva durchbrechen sowie wirkt suizidpräventiv (Reduktion des Suizidrisiko um bis zu 89 %) und Selbstverletzungs-präventiv.
Bei der Therapie mit Lithium ist im Akutfall auch immer eine Lithiumintoxikation zu bedenken. Diese zeigt sich vor allem durch Übelkeit/Erbrechen/Durchfall, einen grobschlägigen Tremor manus, Abgeschlagenheit, psychomotorische Verlangsamung, Vigilanzminderung/Bewusstseinstrübung, Schwindel, Dysarthrie und Ataxie sowie im Verlauf durch Rigor, Hyperreflexie, Faszikulationen, Krampfanfälle und einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Weitere Symptome sind:
- Aufmerksamkeits-, Konzentrations-, Gedächtnis- und Orientierungsstörungen
- Nystagmus
- extrapyramidalmotorische Symptome
- Polyneuropathien
- Inappetenz und/oder Meteorismus
- ARDS
- Polyurie, -dipsie
- renaler Diabetes insipidus
- Hypo- oder Hyperthermie
- Leuko- und Thrombozytopenie
Ursächlich für eine Lithiumintoxikation können z.B. eine akzidentielle Überdosierung, aber auch eine in suizidaler Absicht, sowie Nierenfunktionsstörungen mit Elektrolytverschiebung, Arzneimittelinterkationen mit Medikamenten wie NSAR, ACE-Hemmer, Sartane oder Diuretika sein und Dehydratation. Prädisponierend für eine Lithiumvergiftung sind z.B. Infektionen, eine Geburt, die Perinatalperiode, eine Herzinsuffizienz, eine Leberzirrhose, eine verminderte Natriumaufnahme (z.B. bei Diät) oder eine Anorexie.
Verlauf und Prognose
Wie schon beschrieben bildet sich v.a. die bipolare Störung Typ 1 im frühen Erwachsenalter aus, auch bei zuvor kompletter psychischer Gesundheit, aber oftmals bei bereits vorhandenen depressiven oder hypomanen Symptomen bzw. Episoden. 90 % aller Betroffenen haben nach ihrer ersten manischen Episode einen rezidivierend-chronischen Verlauf mit wechselnden manischen, hypomanischen, depressiven und gemischten Episoden, wobei zu betonen ist, dass der Verlauf individuell sehr variabel ist und nur rund 10 % der Betroffenen mehr als 10 Episoden erleben. Die Wahrscheinlichkeit eines chronischen Verlaufs erhöht sich vor allem bei folgenden Risikofaktoren:
- weibliches Geschlecht
- prämorbid schwerwiegende kritische Lebensereignisse
- unzureichende Bewältigungsressourcen (Coping)
- frühes Erstmanifestationsalter
- verzögerte Diagnosestellung und Behandlung (i.d.R. erst nach 10 Jahren)
- Auftreten von gemischten Episoden
- Rapid Cycling bzw. hohe Episodenfrequenz
- psychotische Symptome
- psychische oder somatische Komorbiditäten (i.d.R. drei oder mehr psychiatrische Komorbiditäten, v.a. Angst- & Substanzkonsumstörungen)
- schlechte Compliance bzgl. der therapeutischen Maßnahmen
- unzureichende Ansprechen auf die phasenprophylaktische Therapie
Im Rahmen der Chronifizierung ist aber trotzdem festzustellen, dass es zwischen den einzelnen affektiven Episoden zu einer weitgehenden Remission der Symptome kommt. Durch Symptomüberlappungen und Maskierungen kommt es aber nicht selten dazu, dass die Diagnosestellung im Verlauf erheblich erschwert ist. Betrachtet man aber die Remissionsraten, so liegt diese bei manischen Episoden nach einem Jahr bei ca. 90 % und ist bei Rapid Cycling und gemischten Episoden erheblich schlechter. Bei der bipolaren Störung Typ 1 besteht zudem das Risiko, dass diese im Verlauf in eine schizoaffektive Störung übergeht.
Prognostisch ist festzustellen, dass mit zunehmender Schwere der Erkrankung bzw. zunehmender Zahl der Episoden gleichzeitig ein niedriger werdender sozioökonomischer Status vergesellschaftet ist. Ursächlich hierfür sind die längeren Zeiträume der Arbeitsunfähigkeit, aber auch zunehmende kognitive Defizite und anderer Behinderungen. Es gilt aber zu betonen, dass der Intelligenzquotient aber unbeeinträchtigt erscheint.
Die Lebensdauer betroffener Patient*innen ist darüber hinaus, wie zu Beginn schon beschrieben, um mehrere Jahre reduziert, auch aufgrund von somatischen Komorbiditäten und einem höheren Risiko für Suizidalität. In Zahlen ausgedrückt haben Betroffene ein sechsfach höheres Risiko für einen Tod durch äußere Ursachen und ein zweifach höheres Risiko für einen Tod durch somatische Ursachen. In Studien lag das Durchschnittsalter bei Todeseintritt bei etwa 50 Jahren und Männer waren zu 2/3 betroffen. Bei den externen Todesursachen waren ca. 58 – 61 % auf einen Suizid zurückzuführen, davon 48 % durch Medikamentenüberdosierung mit verschriebenen Psychopharmaka. Die häufigsten Ursachen für somatische Todesfälle sind laut Untersuchungen:
- Folgeerkrankungen einer Alkoholsucht (ca. 29 %), davon ca. 48 % aufgrund von Lebererkrankungen, ca. 28 % durch Alkoholvergiftungen und 10 % Alkoholabhängigkeit
- Herzkrankheiten und Schlaganfall (jeweils ca. 27 %)
- Krebs (ca. 22 %)
- Atemwegserkrankungen (ca. 4 %)
- Diabetes (ca. 2 %)
- Verhaltensstörungen in Verbindung mit anderem Substanzmissbrauch (ca. 1 %)
Ausblick
Da es sich, wie schon zu Beginn erwähnt, bei einer bipolaren Erkrankung ein episodisches Krankheitsbild handelt, welches aus depressiven Episoden/Perioden im Wechsel mit manischen, gemischten oder hypomanischen Episoden besteht, folgt demnächst thematisch passend der Beitrag zur depressiven Störung. Bis dahin lohnt sich aufgrund des erhöhten Suizidrisikos ein Blick in den Beitrag zur Suizidalität!
Quellen
- Aldenhoff, Josef. Die psychiatrische Notfallmedizin: Management und Therapie. Herausgegeben von Walter Hewer, Thomas Messer, und Wulf Rössler. 3. Auflage. München: Elsevier, 2017.
- Bandelow, Borwin, Oliver Gruber, und Peter Falkai. Kurzlehrbuch Psychiatrie. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. https://doi.org/10.1007/978-3-642-29895-0.
- Bauer, Michael, Andrea Pfennig, Martin Schäfer, und Peter Falkai, Hrsg. S3-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie Bipolarer Störungen. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-662-61153-1.
- Bauer, Michael, Emanuel Severus, und Gerd Laux. „Bipolare affektive Störungen“. Springer Medizin – e.Medpedia, 1. Juni 2016. https://www.springermedizin.de/emedpedia/psychiatrie-psychosomatik-psychotherapie/bipolare-affektive-stoerungen?epediaDoi=10.1007/978-3-642-45028-0_68.
- Beier, Fabrice, Emanuel Severus, und Michael Bauer. „Diagnostik und Therapie bipolarer Störungen“. InFo Neurologie + Psychiatrie 22, Nr. 11 (November 2020): 32–39. https://doi.org/10.1007/s15005-020-1516-x.
- Bschor, T., C. Baethge, H. Grunze, U. Lewitzka, H. Scherk, E. Severus, und M. Bauer. „S3-Leitlinie Bipolare Störungen – 1. Update 2019: Was ist neu in der Pharmakotherapie?“ Der Nervenarzt 91, Nr. 3 (März 2020): 216–21. https://doi.org/10.1007/s00115-019-00852-5.
- Coryell, William. „Bipolare Störungen – Psychische Störungen“. MSD Manual – Ausgabe für medizinische Fachkreise. Zugegriffen 29. Juli 2023. https://www.msdmanuals.com/de-de/profi/psychische-st%C3%B6rungen/affektive-st%C3%B6rungen/bipolare-st%C3%B6rungen.
- Elia, Josephine. „Bipolare Störung bei Kindern und Jugendlichen – Pädiatrie“. MSD Manual – Ausgabe für medizinische Fachkreise, 1. April 2021. https://www.msdmanuals.com/de-de/profi/p%C3%A4diatrie/psychiatrische-st%C3%B6rungen-im-kindes-und-jugendalter/bipolare-st%C3%B6rung-bei-kindern-und-jugendlichen.
- Falkai, Peter, Gerd Laux, Arno Deister, Hans-Jürgen Möller, und Krisztina Adorjan, Hrsg. Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie: 302 Abbildungen. 7., Vollständig überarbeitete Auflage. Duale Reihe. Stuttgart: Thieme, 2022. https://doi.org/10.1055/b000000071.
- Frieling, Helge. „Lithium reduziert Selbstverletzungen bei Menschen mit bipolarer Störung“. DNP – Der Neurologe & Psychiater 18, Nr. 4 (April 2017): 16–16. https://doi.org/10.1007/s15202-017-1628-4.
- Frieling, Helge. „Neue Erkenntnisse zur Therapie und Selbsthilfe bei bipolarer Störung“. DNP – Der Neurologe & Psychiater 21, Nr. 1 (Februar 2020): 13–14. https://doi.org/10.1007/s15202-020-0593-5.
- Goodwin, Gm, Pm Haddad, In Ferrier, Jk Aronson, Trh Barnes, A Cipriani, Dr Coghill, u. a. „Evidence-Based Guidelines for Treating Bipolar Disorder: Revised Third Edition Recommendations from the British Association for Psychopharmacology“. Journal of Psychopharmacology 30, Nr. 6 (Juni 2016): 495–553. https://doi.org/10.1177/0269881116636545.
- Graefe, Karl-Heinz, Werner Lutz, und Heinz Bönisch. Duale Reihe Pharmakologie und Toxikologie. 2., Vollständig überarbeitete Auflage. Duale Reihe. Stuttgart: Thieme, 2016.
- Grunze, Heinz. „Off-Label bei Manie und Depression?“ DNP – Der Neurologe und Psychiater 17, Nr. 7–8 (August 2016): 31–35. https://doi.org/10.1007/s15202-016-1357-0.
- Grunze, Heinz, und Schwäbisch Hall. „Fortschritte in der Diagnostik und Behandlung bipolarer Störungen“. DNP – Der Neurologe & Psychiater 20, Nr. 6 (Dezember 2019): 74–84. https://doi.org/10.1007/s15202-019-2299-0.
- Grunze, Heinz, Thomas Heinrich, und Jörg Walden. „Bipolare Störungen und Sucht“. DNP – Der Neurologe & Psychiater 19, Nr. 5 (Oktober 2018): 40–47. https://doi.org/10.1007/s15202-018-2062-y.
- Häckel, Andreas. „Lithium geht bei bipolaren Störungen mehrfach als Sieger hervor“. DNP – Der Neurologe & Psychiater 18, Nr. 5 (Mai 2017): 10–10. https://doi.org/10.1007/s15202-017-1659-x.
- Hartleb, Riccarda Carina. „Risikofaktoren für Suizidversuche bei bipolarer Störung“. Diplomarbeit, Medizinischen Universität Graz, 2017. https://online.medunigraz.at/mug_online/wbabs.getDocument?pThesisNr=53601&pAutorNr=84406&pOrgNR=1.
- Hasler, Gregor, Martin Preisig, Thomas J. Mller, Wolfram Kawohl, Jean-Michel Aubry, und Waldemar Greil. „Bipolare Störungen: Update 2019“. Swiss Medical Forum ‒ Schweizerisches Medizin-Forum, 14. August 2019. https://doi.org/10.4414/smf.2019.08325.
- Hirschfeld, Robert M. A., Charles L. Bowden, Michael J. Gitlin, Paul E. Keck, Trisha Suppes, Michael E. Thase, und Roy H. Perlis. Practice guideline for the treatment of patients with bipolar disorder, second edition. American Psychiatric Association practice guidelines for the treatment of psychiatric disorders: Compendium 2002. Arlington, VA, US: American Psychiatric Association, 2002. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.160.8.1531.
- International Bipolar Foundation. „Die Situation bipolar Erkrankter in Deutschland“. International Bipolar Foundation, 25. März 2013. https://ibpf.org/wp-content/uploads/healthy-living-book/Bipolar-Disorder-in-Germany.pdf.
- Jefsen, Oskar Hougaard, Annette Erlangsen, Merete Nordentoft, und Carsten Hjorthøj. „Cannabis Use Disorder and Subsequent Risk of Psychotic and Nonpsychotic Unipolar Depression and Bipolar Disorder“. JAMA Psychiatry, 24. Mai 2023. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2023.1256.
- Köhler, S., L. Stöver, und P. Sterzer. „Die gemischte Episode bei bipolarer affektiver Störung – Änderungen im DSM-5 und aktuelle Behandlungsempfehlungen“. Fortschritte der Neurologie · Psychiatrie 83, Nr. 11 (3. Dezember 2015): 606–15. https://doi.org/10.1055/s-0041-109017.
- Messer, T., und F. -G. B. Pajonk. „Psychose und Manie: Wie erkennen und wie im Notfall handeln?“ Notfall + Rettungsmedizin 19, Nr. 3 (Mai 2016): 180–84. https://doi.org/10.1007/s10049-016-0149-6.
- Mühlig, Stephan. „bipolare Störungen“. Dorsch – Lexiko der Psychologie, 27. September 2022. https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/bipolare-stoerungen.
- Mullins, Niamh, Andreas J. Forstner, Kevin S. O’Connell, Brandon Coombes, Jonathan R. I. Coleman, Zhen Qiao, Thomas D. Als, u. a. „Genome-Wide Association Study of More than 40,000 Bipolar Disorder Cases Provides New Insights into the Underlying Biology“. Nature Genetics 53, Nr. 6 (Juni 2021): 817–29. https://doi.org/10.1038/s41588-021-00857-4.
- National Institute of Mental Health. „Bipolar Disorder“. National Institute of Mental Health (NIMH). Zugegriffen 31. Juli 2023. https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/bipolar-disorder.
- Pajonk, Frank-Gerald, Thomas Messer, und Horst Berzewski, Hrsg. S2k-Leitlinie Notfallpsychiatrie. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-662-61174-6.
- Paljärvi, Tapio, Kimmo Herttua, Heidi Taipale, Markku Lähteenvuo, Antti Tanskanen, Seena Fazel, und Jari Tiihonen. „Cause-Specific Excess Mortality after First Diagnosis of Bipolar Disorder: Population-Based Cohort Study“. BMJ Mental Health 26, Nr. 1 (Mai 2023): e300700. https://doi.org/10.1136/bmjment-2023-300700.
- Paulzen, M., G. Gründer, und O. Benkert. „Medikamente zur Behandlung bipolarer Störungen“. In Kompendium der Psychiatrischen Pharmakotherapie, herausgegeben von Otto Benkert und Hanns Hippius, 201–68. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-662-50333-1_2.
- Payk, Theo R. Psychopathologie: vom Symptom zur Diagnose. 5., Vollständig überarbeitete Auflage. Lehrbuch. Berlin [Heidelberg]: Springer, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-662-63574-2.
- Pharmazeutische Zeitung. „Loxapin|Adasuve®|71|2013“. Pharmazeutische Zeitung online, 7. Januar 2022. https://www.pharmazeutische-zeitung.de/arzneistoffe/daten/2013/loxapinadasuve174712013/.
- Porjalali, Shahrouz. Lernkarten Psychiatrie und Neurologie für Pflege- und Altenpflegeberufe. 1. Aufl. München: Elsevier, Urban & Fischer, 2010.
- Psylex. „Bipolare Störung: Statistik, Epidemiologie“. Psylex. Zugegriffen 31. Juli 2023. https://psylex.de/stoerung/bipolar/statistik/.
- Rowland, Tobias A., und Steven Marwaha. „Epidemiology and Risk Factors for Bipolar Disorder“. Therapeutic Advances in Psychopharmacology 8, Nr. 9 (September 2018): 251–69. https://doi.org/10.1177/2045125318769235.
- Schäfer, Martin. „Sublingualtablette zur Selbstbehandlung?“ InFo Neurologie + Psychiatrie 24, Nr. 5 (Mai 2022): 26–27. https://doi.org/10.1007/s15005-022-2361-x.
- Schneider, Frank, Hrsg. Facharztwissen Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-662-50345-4.
- Seifert, Roland. „Arzneistoffe zur Behandlung der Depression und bipolaren Störung“. In Basiswissen Pharmakologie, von Roland Seifert, 385–99. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-662-60504-2_28.
- Severus, E., und M. Bauer. „Bipolare Störungen im DSM-5“. Der Nervenarzt 85, Nr. 5 (Mai 2014): 543–47. https://doi.org/10.1007/s00115-013-3987-1.
- Severus, Emanuel, und Michael Bauer. „Bipolar-I-Störung“. Thieme eRef, 4. November 2022. https://eref.thieme.de/cockpits/clPsych001/0/coPsych0105/0?context=search#.
- Spies, Claudia, Marc Kastrup, Thoralf Kerner, Christoph Melzer-Gartzke, Hendrik Zielke, und Wolfgang Kox, Hrsg. SOPs in Intensivmedizin und Notfallmedizin: Alle relevanten Standards und Techniken für die Klinik. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2013. https://doi.org/10.1055/b-002-57162.
- Stratmann, Mirjam, und Carsten Konrad. „Manie, Bipolare Störung“. In Kompendium der Psychotherapie, herausgegeben von Tilo Kircher, 135–71. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012. https://doi.org/10.1007/978-3-642-23664-8_8.
- Yatham, Lakshmi N, Sidney H Kennedy, Sagar V Parikh, Ayal Schaffer, David J Bond, Benicio N Frey, Verinder Sharma, u. a. „Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) 2018 Guidelines for the Management of Patients with Bipolar Disorder“. Bipolar Disorders 20, Nr. 2 (März 2018): 97–170. https://doi.org/10.1111/bdi.12609.
- Zimmermann, Wolfgang. „Bipolare Störungen: Expertenkonsensus zum Assessment und Management der Agitation“. NeuroTransmitter 28, Nr. 3 (März 2017): 52–53. https://doi.org/10.1007/s15016-017-5904-5.
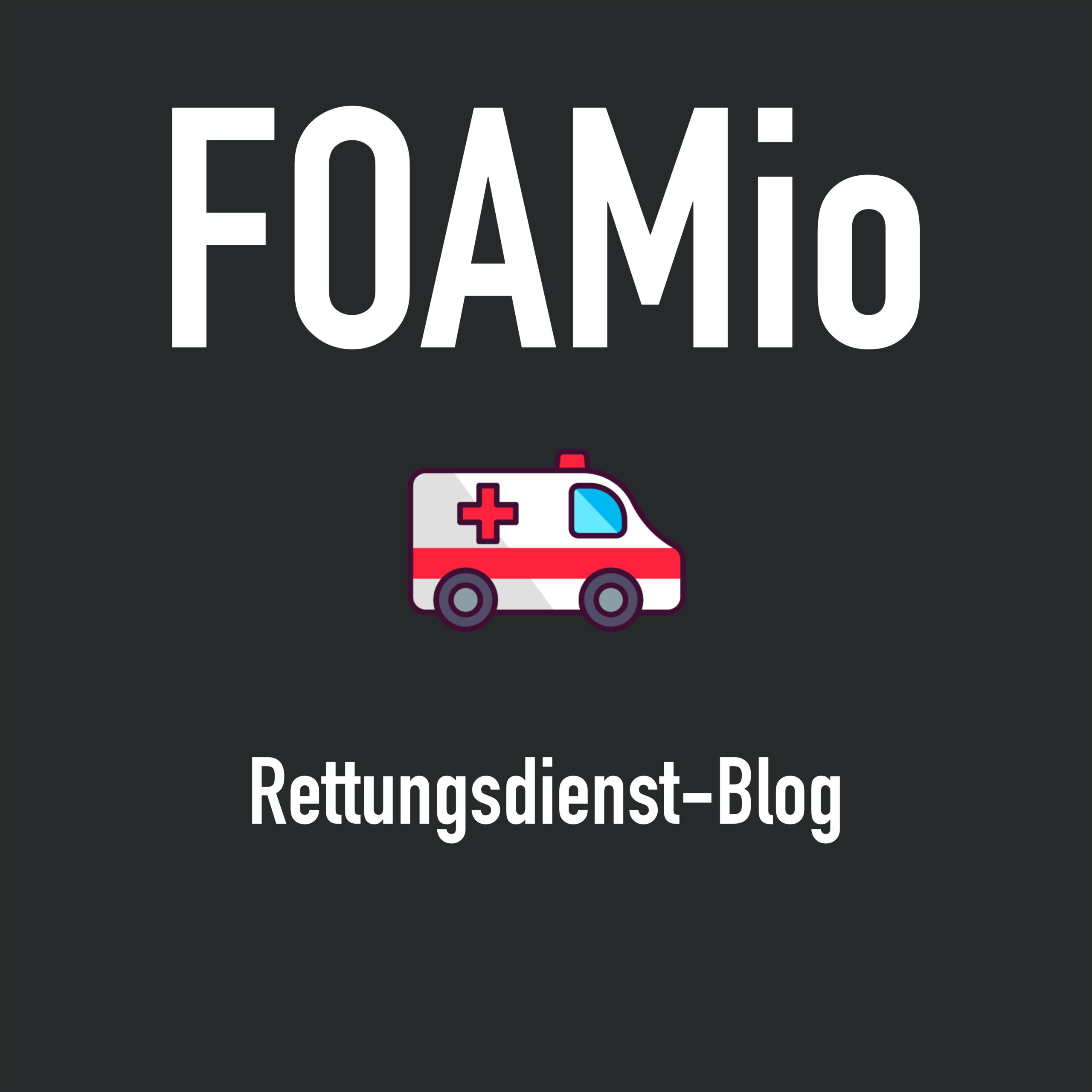

Sei der Erste der einen Kommentar abgibt